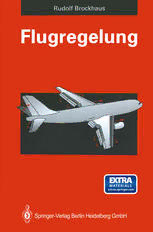Table Of ContentRudolf Brackhaus
Flugregelung
Physikalische Grundlagen
Mathematisches Flugzeugmodell
Auslegungskriterien - Regelungsstrukturen
Entwurf von Flugregelungssystemen
Entwicklungslinien
Mit einem Geleitwort von Mare Pelegrin
Mit 536 Abbildungen
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Universitatsprof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus
Technische Universitat Braunschweig
Institut fiir Flugftihrung
Rebenring 18, D- 38106 Braunschweig
ISBN 978-3-662-07267-7 ISBN 978-3-662-07266-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-07266-0
Additional material to this book can be downloaded from http://extras.springer.com
D1e Deut~che B1bhothek - CIP-E10he1tsaufnahme
Brockhau~. Rudolf
Flugregelung I Rudolf Brockhaus M1t e1nem Gele1tw von Marc Pelegnn -
Berlin, He1delberg, New York, London, Pans, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest
Spnnger, 1994
ISBN 978-3-662-07267-7
D1eses Werk 1~1 urheberrechtllch geschutzt D1e dadurch begrundeten Rechte, msbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abb1ldungen und Tabellen, der Funks
endung. der M•kroverf1lmung oder der Verv•elfaltlgung auf anderen Wegen und der Spe1cherung 1n
Datenverarbeitungsanlagen, ble1ben, auch be1 nur auszugswe1ser Verwertung, vorbehalten. E10e Verv!el
faltlgung d1eses Werkes oder von Tellen d1eses Werkes 1st auch 1m Emzelfall nur 10 den Grenzen der
gesetzllchen Bestimmungen des Urheberrecht~gesetzes der Bundesrepubhk Deutschland vom 9. September
1965 10 der JeWe!ls geltenden Fassung zulass1g S1e 1st grundsatzhch vergutungspfhchtlg. Zuwiderhand
lungen unterhegen den Strafbesttmmungen des Urheberrechtsgesetzes
© 1994 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York in 1994
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1994
D1e W1edergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbeze1chnungen u;w In d1e;em Werk berech
tlgt auch ohne besondere Kennze1chnung mcht zu der Annahme, daB solche Namen 1m Smne der
Warenze1chen-und Markenschutz-Ge;etzgebung ab fre1 zu betrachten waren und daher von Jedermann
benutzt werden durften
Sollte m d1esem Werk duekt oder 10duekt auf Gesetze, Vor;chnften oder R1chthmen (z.B DIN, VDJ,
VDE) Bezug genommen oder aus 1hnen Zltlert worden se10, so kann der Verlag keme Gewahr fur
R1chugke1t, Vollstand•gkelt oder Aktuahtat ubernehmen Es empf1ehlt s1ch, gegebenenfalls fur die
e1genen Arbeiten d1e vollstand•gen Vorschnften oder R1chthmen 10 der Jewells gultlgen Fassung h10zuzu
z1ehen
Satz· Reprodukttonsferllge Vorlagen vom Au tor
SPIN I 0064878 62/3020 -5 4 3 2 I -Gedruckt auf ;aurefre1em Pap1er
Geleitwort
"Pilot oder Autopilot": le titre de ce premier paragraphe de l'introduction pourrait
etre le titre meme de l'important ouvrage que Rudolf Brackhaus vient d'achever.
L 'Aeronautique, plus rapidement que les autres techniques, suit le cours inexorable
du progres. L'Aeronautique n 'est autre chose qu 'un vaste "outil generalise": l'homme,
apres analyse des tliches qu 'il effectue, essaie de les transposer sur machine afin
d' allegrer sa fatigue ou d' eviter La monotonie d'une tliche repetitive; parfois il demande
a
La machine des tliches qu 'il estime trop difficiles, voir dangereuses, pour lui ... ce
n 'estfort heureusement pas le cas de l'Aeronautique.
Cependant, cette transposition a ete faite trop brutalement dans l'a pogee de
l'Automatique, dans/es annees 1950-70. Depuis l'automaticien s'est rendu campte que
l'h omme devait etre pris en campte dans le "systeme" de La meme faron, si possible, que
les composants physiques le sont - dijjicile problerne dont La solution globale est tou
jours en gestation.
Si l'avion hait seul dans le ciel, alors le vol complet (sauf acceleration sur piste,
rotation, prise d'a ssiette initiale) pourrait etre automatique (a tterrissage et freinage sur
piste compris). Mais l'avion n'estjamais seul dans le ciel et l'equipage doit modijier les
donnies du "plan de vol" en permanence dans les zones denses. De plus, l'incident,
bien que rare, existe encore et existera toujours, La fiabilite absolue n 'existant pas. Il y
aura donc toujours dialogue entre l'equipage, le controle sol et La machine.
C' est, je pense, un tres grand merite de ce Livre, qui a cote des problemes de
mecanique du vol et de physique des systemes etudie La place de l'homme, soit dans La
definition des specifications pour un sous-systeme donne, soit pour La gestion du vol
dans son ensemble.
Le veritable titre de cet ouvrage n 'est-il pas "Pilot und Autopilot"?
Prof. Mare Pelegrin
ENSAE Toulouse,
Membre correspondant
de I' Academie des Sciences, Paris.
Übersetzung des Geleitwortes
"Pilot oder Autopilot": Die Überschrift dieses ersten Abschnitts der Einführung könnte
der Titel dieses ganzen umfangreichen Werkes sein, das Rudolf Brackhaus gerade
vollendet hat.
Die Luftfahrt folgt schneller als andere Zweige der Technik dem unerbittlichen Lauf des
Fortschritts. Sie ist nichts anderes als ein vielseitiges Großwerkzeug: nach einer Analyse
seiner Aufgaben versucht der Mensch, diese auf eine Maschine zu verlagern, um sich
von Ermüdung zu befreien oder um der Monotonie einer sich wiederholenden Aufgabe
zu entgehen. Manchmal überträgt er der Maschine Aufgaben, die er für sich selbst als zu
schwierig oder gar gefährlich erachtet -letzteres ist zum Glück in der Luftfahrt nicht der
Fall.
Indes, diese Übertragung von Aufgaben hat sich während der stärksten Entwicklungs
phase der Automatisierungstechnik in den Jahren 1950-70 zu schnell und unerwartet
vollzogen. Seither ist dem Regelungstechniker klar geworden, daß der Mensch in dem
"System" soweit wie möglich in gleicher Weise berücksichtigt werden muß, wie die tech
nischen Komponenten -ein schwieriges Problem, dessen globale Lösung immer noch
auf sich warten läßt.
Wäre das Flugzeug allein im Luftraum, so könnte der gesamte Flug (bis auf die Be
schleunigungs- und Startphase) automatisiert werden (Landung und Abbremsen auf der
Landebahn eingeschlossen). Aber das Flugzeug hat den Himmel nie für sich allein und
die Besatzung muß in Zonen hoher Verkehrsdichte ständig die Daten des "Flugplans"
modifizieren. Darüber hinaus existiert der Zwischenfall immer noch, wenn er auch sel
ten ist. Er wird immer existieren, da es eine absolute Zuverlässigkeit nicht gibt. Es wird
also immer einen Dialog geben zwischen der Besatzung, der Bodenkontrolle und der
Maschine.
Es ist, wie ich denke, ein großes Verdienst dieses Buches, daß neben den Problemen der
Flugphysik und der Systemtechnik auch die Stellung des Menschen betrachtet wird, sei es
bei der Definition von Auslegungskriterien für eines der Untersysteme, sei es in Bezug
auf das Management des gesamten Fluges.
Sollte der Titel dieses Buches nicht eher lauten: "Pilot und Autopilot" ?
M.P.
Vorwort
Dieses Buch war zunächst als Überarbeitung und Aktualisierung der beiden Bändchen
Flugregelung 1-Das Flugzeug als Regelstrecke (1977) und Flugregelung II- Entwurf
von Regelsystemen (1979) geplant. Während der Arbeiten entstand aber ein nach Ziel
vorstellung und Aufbau völlig neuesundstofflich wesentlich erweitertes Werk. Grund
für das neue Konzept war zunächst die Tatsache, daß in den inzwischen vergangeneo
fünfzehn Jahren die Flugregelung revolutioniert wurde. Im Jahre 1987 flog mit dem
Airbus A320 zum ersten Mal ein ziviles Transportflugzeug rein elektrisch ohne Vor
handensein einer mechanischen Primärsteuerung. Die Cockpitbesatzung von Passagier
flugzeugen hatte sich zunächst von vier auf drei, dann auf zwei Personen reduziert,
nachdem Rechner zu den wachsenden Regelungsaufgaben schrittweise auch solche der
Überwachung, Navigation und Flugplanung übernommen hatten. Die Einführung der
Digitaltechnik führte zur Zusammenfassung der vielen unkoordinierten Einzelregler zu
einem integrierten Gesamtsystem und machte neue, bisher nur auf dem Papier existie
rende Lösungen möglich. Im militärischen Bereich hat inzwischen die Idee vom "can
trot configured vehicle" reale Gestalt angenommen und in Zivilflugzeugen ist der Ein
satz von Regelungstechnik zur Verbesserung der Flugleistungen oder zur Reduzierung
des Strukturgewichts keine Utopie mehr.
Der zweite Grund für die Neubearbeitung liegt in dem Lernprozeß, den ich in fünfzehn
Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit durchgemacht habe. In Vorlesungen an der TU
Braunschweig, der NPU Xian und dem IT Bandung, bei Weiterbildungskursen und in
Gesprächen mit Studenten und Mitarbeitern ist mancher schwierige Zusammenhang
durch eine einfache Modellvorstellung verständlicher geworden. Forschungsarbeiten
auf dem Gebiet der Flugreglerkonzepte, des Zusammenwirkens von Pilot und Regler,
der Modellbildung und Simulation, der Systemidentifizierung und der nichtlinearen
Filter so wie deren Verifizierung im Flugversuch haben meinen Blick für die Kompli
ziertheit realer Probleme geschärft. Diese Arbeiten haben durch die langjährige enge
Zusammenarbeit mit Kollegen an der TU Braunschweig und im Forschungszentrum
Braunschweig der DLR im Rahmen zweier Sonderforschungsbereiche, dem SFB 58
"Flugführung" (1969- 83) und dem SFB 212 "Sicherheit im Luftverkehr" (1983- 94)
entscheidende Impulse erhalten. Schließlich habe ich viel aus den Forschungsarbeiten
meines Freundes und Kollegen am Institut für Flugführung, Prof. Dr.-Ing. Gunther
Schänzer gelernt. Sein innovativer Ideenreichtum hat meine Arbeiten entscheidend be
fruchtet. Er und seine Mitarbeiter haben bei der Flugregler-Realisierung, der Windmes
sung und -modellierung und bei der Flugzeugführung mit Hilfe von Trägheitsnaviga
tion und Differential-GPS neue Maßstäbe gesetzt.
Flugregelung dient der Erfüllung regelungstechnischer Aufgaben in einem Fahrzeug,
das sich in sechs Freiheitsgraden in einem weiten Bereich von Höhe und Machzahl be
wegt, das von einem Menschen geführt wird und in dem Menschen transportiert wer-
VIII Vorwort
den. Ebenso kompliziert und vielgestaltig wie der zu regelnde Prozeß sind die einge
setzten Regelungssysteme; beide befinden sich zudem in einer fortwährenden Wei
terentwicklung. Es ist daher wenig hilfreich, in einem Lehrbuch über Flugregelung eine
Vielzahl von Einzelproblemen nebeneinander zu erläutern oder aktuelle, aber evtl.
kurzlebige Sonderlösungen zu behandeln. Die komplizierten Details werden nur dann
verständlich, wenn die grundlegenden Zusammenhänge so einfach wie irgend möglich
dargestellt werden. Mein Ziel war es daher, allgemeine Grundprinzipien verständlich zu
vermitteln und die Vielfalt der Einzellösungen durch ordnende Systematik überschau
bar zu machen. Dazu waren sowohl präzise Definitionen und exakte mathematische
Ansätze nötig, als auch einfache, übertragbare Modellvorstellungen und in ihrem Gül
tigkeitsbereich klar abgrenzbare Näherungslösungen.
Die Aufgaben der Flugregelung entstammen gleichermaßen Problemstellungen der
Flugmechanik und der Flugführung. Sie reichen von der Verbesserung der Flugeigen
schaften (Stabilität, Steuer-und Störverhalten) bis hin zur sicheren Führung auf wech
selnden Flugbahnen innerhalb eines stetig dichter werdenden Luftverkehrs. Während in
der Literatur häufig nur einer dieser beiden Aufgabenkomplexe behandelt wird, habe
ich versucht, beide so weit wie möglich unter übergeordneten Gesichtspunkten mitein
ander zu verbinden.
Modeme Flugregler lassen sich nicht mehr unter Zugrundelegung einer linearen Über
tragungsfunktion der Strecke ("nach Polen und Nullstellen") auslegen, sondern
erfordern weit umfangreichere Prozeßkenntnisse. Das ist der Grund, warum dieses
Buch etwa je zur Hälfte dem Prozeßmodell und den Regelungssystemen gewidmet ist.
Neue Aufgabenstellungen erfordern für Simulation und Flugreglerentwurf eine wach
sende Genauigkeit und Ausführlichkeit des mathematischen Modells. Die schnell fort
schreitende Rechnertechnologie stellt für dessen numerische Realisierung an jedem Ar
beitsplatz ausreichend Rechenleistung zur Verfügung. Aus diesen Gründen habe ich
hier noch konsequenter als im früheren Buch von der Verwendung nichtlinearer Vek
torgleichungen Gebrauch gemacht. Zu den Vorteilen der kompakteren Schreibweise,
der geringeren Fehlerträchtigkeit und der direkten Übertragbarkeit in Rechenpro
gramme kommt die Möglichkeit, daraus jederzeit durch geeignete Vernachlässigungen
Näherungsansätze für Sonderfälle ableiten zu können.
Im Vordergrund der Darstellung steht die Entwicklung herkömmlicher und moderner
Regler-Architekturen auf der Basis der Flugphysik, der Aufgabenstellungen und der
Güteforderungen. Damit soll das Verständnis der Funktion konventioneller und neuercr
Regler erleichtert werden und es sollen Denkanstöße für eine Weiterentwicklung dieser
Strukturen gegeben werden. Zur Entwicklung neuer, innovativer Lösungen ist das Ein
bringen aller verfügbaren flugmechanischen und regelungstechnischen Erfahrung nötig.
Daher werden hier für Modeliierung und Reglerentwurf nebeneinander Methoden im
Zeitbereich und im Frequenzbereich eingesetzt. Die Regler-Architekturen bauen auf
den klassischen Grundstrukturen PID-Regler, Kaskadenregelung, Zustandsvektorrück
führung und nichtlineare Vorsteuerung auf, die pragmatisch auf den Fall des Mehrgrö
ßensystems erweitert werden.
Die zwanzig Kapitel dieses Buches sind in sieben Bereiche gegliedert. Das erste Kapi
tel vermittelt eine allgemeine Übersicht für den auf diesem Gebiet noch wenig bewan
derten Leser. Es stellt sozusagen eine Kurzfassung des gesamten nachfolgenden Textes
Vorwort IX
auf einem einführenden Niveau dar und soll dessen Verständnis erleichtern und die Zu
sammenhänge aufzeigen.
Die Kapitel zwei bis vier liefern die notwendigen physikalischen Grundlagen für die
Beschreibung der Flugzeugbewegung in gestörter Atmosphäre. Dazu gehört zunächst
die Definition aller flugmechanischen und navigatorischen Größen und ihrer Zusam
menhänge, dann die Beschreibung der Ursachen und Wirkungen der aerodynamischen
Kräfte und des Triebwerksschubes und schließlich notwendigerweise die Modeliierung
der Luftbewegung und ihrer Wechselwirkung mit dem Flugzeug.
Die Kapitel fünf bis acht sind der Herleitung des mathematischen Prozeßmodells und
seiner Analyse gewidmet. Die nichtlinearen Vektor-Differentialgleichungen werden
schrittweise vereinfacht und schließlich linearisiert. Blockschaltbilder und Signalfluß
diagramme sollen den Überblick über die komplexen Zusammenhänge erleichtern. Ei
gendynamik und Steuerverhalten werden sowohl an Hand nichtlinearer als auch lineari
sierter Gleichungen analysiert.
Die Darstellung der Randbedingungen zur Reglerauslegung ist Inhalt der Kapitel neun
bis elf. Diese betreffen erstens die Schnittstellen zwischen Flugzeug und Regler, d.h.
die Meßverfahren und Sensoren und die Steuersysteme und Aktoren. Darauf folgt eine
kurze Darstellung des Aufgabenspektrums für Flugregler und deren Auslegungs
kriterien, wobei Randbedingungen der Flugmechanik und der Flugführung angespro
chen werden.
Die Kapitel zwölf und dreizehn geben eine kurze Einführung in Regelungsverfahren,
die sich in der Flugregelung besonders bewährt haben. Im Vordergrund stehen dabei
Reglerstrukturen zur Modifikation des dynamischen Verhaltens, die sich vornehmlich
für die Regelung der rotatorisehen Freiheitsgrade eignen, und solche zur Prozeßfüh
rung, die besonders für die Regelung der translatorischen Freiheitsgrade und für die
Bahnführung Bedeutung erlangt haben. Auf eine ausführliche Behandlung regelungs
technischer Theorien und Entwurfsverfahren habe ich dagegen verzichtet und entspre
chende Grundkenntnisse vorausgesetzt, da hierzu eine Vielzahl hervorragender Lehrbü
cher existiert.
In den Kapiteln vierzehn bis siebzehn werden schließlich die wichtigsten Flugregler
Strukturen erläutert. Nach der Auswahl wirksamer Rückführungen für die Stabilitäts
verbesserung werden die Basisregler für Längs- und Seitenbewegung eingeführt, die
der Modifikation der Flugeigenschaften dienen. Diese Betrachtung wird vertieft durch
die Behandlung der wichtigsten Maßnahmen zur Erweiterung der Flugbereichsgrenzen,
die unter dem Begriff "Aktive Regelung" zusammengefaßt werden.
Darauf folgt die Darstellung der klassischen Autopiloten, und zwar fortschreitend von
Einzelreglern zur Stabilisierung von Höhe, Fahrt und Kurs im Reiseflug bis zum Rege
lungssystem für die automatische Landung. Schließlich werden neue Entwicklungen
verkoppelter ("integrierter") Regler für die Führung auf wechselnden Flugbahnen vor
gestellt, die teilweise in neuesten kommerziellen Systemen, teilweise aber erst in Expe
rimentalsystemen realisiert wurden. Sie sind charakterisiert durch die Verbindung
pragmatisch ausgewählter Zustandsrückführung mit einer nichtlinearen Vorsteuerung,
die aus der flugmechanischen Prozeßkenntnis heraus entwickelt wird. Hieran schließen
sich neue Konzepte für die Generierung von Solltrajektorien und die daraus abgeleitete
X Vorwort
Sollzustandsgenerierung an. Dabei wird auch die Einbindung des Augregelungssystems
in die übrigen Bordsysteme (Navigation, Flight Management) erläutert.
Den Schnittstellen zwischen Pilot und Regelungssystem ist ein gesondertes Kapitel
gewidmet. Hier werden Strukturen des Zusammenwirkens von Pilot und Autopilot dis
kutiert, die auf rein elektrischer Steuerung ("Fly-by-Wire") und intelligenten Anzeige
systemen ("Flight Director") basieren und wesentlich zu höherer Flexibilität der Flug
zeugführung beitragen.
Die beiden abschließenden Kapitel behandeln aktuelle Beispiele für das Gesamtsystem
und zwar jeweils eins aus dem militärischen und aus dem zivilen Bereich. Die eher sy
stematischen Ausführungen der vorangehenden Kapitel werden hier konkretisiert und
aktualisiert.
Im Anhang sind die Bewegungsgleichungen und ihre Parameter nochmals zusammen
gestellt. Sie sind in dieser Form auch für die numerische Simulation geeignet. Flugme
chanische Daten, Sprungantworten und Bode-Diagramme mehrerer Beispielflugzeuge
sollen zahlenmäßige Abschätzungen erleichtern und eigene Beispielrechnungen er
möglichen. Die entsprechenden Grafiken wurden mit Hilfe von MATLAB® erstellt.
Diese Daten sind zusammen mit einer MATLAB-Toolbox zur Flugzeugsimulation und
zum Reglerentwurf auf einer Diskette beigefügt. Häufig verwendete Größen und Kon
stanten und eine Tabelle der Standardatmosphäre sind angefügt.
Das Buch wendet sich an Studenten der Luftfahrttechnik und der Regelungstechnik und
kann als Grundlage für vertiefte Vorlesungen und Weiterbildungskurse auf diesem Ge
biet dienen. Es wendet sich gleichermaßen an Ingenieure in Forschung, Industrie, bei
Luftfahrtgesellschaften und Behörden, und zwar sowohl an den Flugreglerspezialisten
als auch an den System-Integrierer. Damit es neben der Funktion eines Lehrbuchs auch
die eines Nachschlagewerks erfüllen kann, ist der Stoff eher nach systematischen als
nach didaktischen Gesichtspunkten gegliedert und es sind viele Querverweise in den
Text eingefügt.
Das Literaturverzeichnis ist zur stofflichen Strukturierung nach Kapiteln gegliedert. Die
Literatur ist dort eingeordnet, wo sie zum ersten Mal zitiert wird. Das ausführliche
Sachverzeichnis soll bei der Begriffsbestimmung und bei der Orientierung helfen; fette
Seitenzahlen weisen auf eine Definition des entsprechenden Begriffs hin. Die vielen, in
der Flugregelung gebräuchlichen englischen Begriffe werden ebenfalls definiert, sie
werden so weit irgend möglich durch deutsche Begriffe ersetzt und sind im Text kursiv
geschrieben. Gebräuchliche Abkürzungen sind im Anhang zusammengestellt.
Ich habe mich bemüht, Begriffe, Benennungen und Formelzeichen möglichst aus exi
stierenden Normen zu übernehmen. Wo solche nicht ausreichten, habe ich neue Größen
nach gleichen Prinzipien definiert. Flugtechnische und regelungstechnische Größen
sind in der Zeichenerklärung parallel zueinander zusammengestellt. Physikalische Vek
toren sind durch einen darübergesetzten Pfeil gekennzeichnet. Allgemeine Vektoren,
z.B. Zustandsvektoren, und Matrizen werden im Unterschied dazu, wie in der rege
lungstechnischen Literatur üblich, durch Unterstreichung gekennzeichnet. Gleichungen
behalten stets die Nummer, unter der sie eingeführt wurden, damit man ihre Herleitung
leicht finden kann.