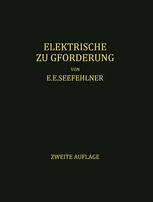Table Of ContentELEKTRISCHE
••
ZUGFORDERUNG
HANDBUCH FÜR THEORIE UND ANWENDUNG DER
ELEKTRISCHEN ZUGKRAFT AUF EISENBAHNEN
VON
DR.-ING. E. E. SEEFEHLNER
WIEN
MIT EINEM KAPITEL ÜBER ZAHNBAHNEN
UND DRAHTSEILBAHNEN
VON
ING. H. H. PETER
ZÜRICH
ZWEITE
VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE
MIT 751 ABBILDUNGEN IM TEXT
UND AUF EINER TAFEL
SPRINGER-VERLAG BERllN HEIDELBERG GMBH
ISBN 978-3-642-50633-8 ISBN 978-3-642-50943-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-50943-8
ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN.
COPYRIGHT 1922 BY SPRINGER-VERLAG BERUN HEIDELBERG
URSPRÜNGUCH ERSCHIENEN BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.1922
SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 2ND EDITION 1922
Vorwort zur ersten Auflage.
Die gegenseitige Abgeschlossenheit der verschiedenen technischen Gebiete bildet ein
arges Hindernis für den Fortschritt der Technik. Die Denkungsarten der Berufskreise
verschiedener Fachgebiete sind oft ohne ausreichende Berührungspunkte und stehen
einander meist fremd gegenüber.
Diese Sachlage ist besonders für die Elektrotechnik kennzeichnend, die, in ihrem
Siegeslauf ihre eigenen Wege gehend, alle anderen Fachgebiete nach ihren eigenen Zielen
umgestaltet hat. Sie bildet gewissermaßen eine Welt, ein Reich für sich. Diese Art
konnte überall dort zum Ziele führen, wo die bestandenen Betriebsmethoden im Wett
bewerb mit der elektrischen Betriebskraft nicht standhalten konnten. Die Sachlage lag
z. B. bei den Straßenbahnen mit früher animalischer Zugkraft vor. Helfend stand der
Elektrotechnik im Kampf um dieses Gebiet der Umstand zur Seite, daß wegen Minder
wertigkeit des Pferdebetriebes und der damaligen Rückständigkeit des Städtewesens
überhaupt die Straßenbahnnetze noch keine nennenswerte Ausdehnung aufwiesen.
Diese Betrachtungen gewähren Einblick in die Ursachen, die der Einführung des
elektrischen Betriebes bei den Vollbahnen überall im Wege stehen. Bei der mit vollem
Rechte im Interesse der Betriebssicherheit zähe festgehaltenen Beständigkeit in der
Eisenbahntechnik muß die Elektrotechnik hier andere Wege einschlagen, um zum Ziele
zu gelangen. Die der neuen Betriebskraft entsprechende Umgestaltung des Eisenbahn
wesens kann wegen der Größe dieses Fachgebietes vorerst aus finanziellen und auch
technischen Gründen nicht erwartet werden. Dieses Ziel steht in zweiter Reihe; zunächst
muß die Elektrotechnik die Fragen der Zugförderung auf konservativer Grundlage
schrittweise zu lösen trachten. Hierzu ist es nötig, sich die Denkweise der Eisenbahn
techniker anzueignen und die Elektrotechnik nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel
zum Zweck zu behandeln. Es ist auch nötig, das Wesen der Straßen- und Lokalbahn
technik voll zu beherrschen, um erkennen zu können, was auf die Vollbahntechnik nicht
übertragen werden darf.
In Amerika, wo die elektrische Zugförderung auch der Vollbahnen schon auf be
deutende Ausführungen hinweisen kann, hat man diese Sachlage erkannt und findet es
für zweckdienlich, Spezialingenieure in diesem Sinne heranzubilden.
Die deutschen Hochschulen behandeln zwar die "elektrischen Bahnen", aber, soweit
meine Kenntnis reicht, unter ausgesprochener Bevorzugung des elektrotechnischen Stand
punktes und geringer Beachtung der eisenbahntechnischen Beziehungen. Bei der knapp
bemessenen Zeit der Studierenden, dem ungeheueren Umfang der Elektrotechnik und
des ebenfalls zu bewältigenden Maschinenbauwesens, t'lchließlich der verhältnismäßig
geringen Zahl der Studierenden, die sich bisher dem elektrischen Bahnwesen zuwandten,
mußte man sich mit dieser Sachlage abfinden.
Die in die Praxis tretenden Ingenieure müssen daher die Grundzüge dieses Sonder
gebietes erst in ihrer praktischen Tätigkeit und durch diese erwerben.
Den solcherart mühevollen Weg zur Beherrschung dieses Gegenstandes unter weit
gehendster Preisgabe der gesammelten Erfahrungen zu kürzen und den Gegenstand in
IV Vorwort zur ersten Auflage.
der angedeuteten eisenbahntechnischen Einstellung zu behandeln, hat sich der Verfasser
seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Praxis des elektrischen Bahnwesens stehend -
mit dem gegenwärtigen "Handbuch" zur Aufgabe gemacht, wobei der Umstand mit
bestimmend war, daß die "Elektrische Zugförderung der Eisenbahnen" in der deutschen
Literatur bislang von keinem Verfasser in Gänze und auf einheitlicher Grundlage be
handelt wurde. Es liegen Arbeiten nur über einzelne Sondergebiete vor.
Der Verfasser setzt in Übereinstimmung mit der üblichen Organisation des Elektro
Bahningenieurtums voraus, daß dem elektrischen Bahningenieur die Grundzüge der
Elektrotechnik geläufig sind und daß er, ohne sich mit Berechnung, Entwurf und Er
zeugung elektrischer Maschinen und Apparate zu befassen, deren Eigenschaften so weit
beherrscht, daß er dann an Hand der hier gegebenen Anleitungen und Überlegungen
die richtige Wahl treffen kann.
Die Zugförderung ist der Lebenszweck der Eisenbahn, sie bildet daher den wich
tigsten Dienstzweig des Betriebes. Im Dampfbetrieb befaßt sich der technische Dienst
der Zugförderung nur mit dem für den Transport dienenden beweglichen Inventar,
indem die Kraft zur Zugbewegung im Zuge selbst erzeugt und verbraucht wird.
Vom Selbstfahrerbetrieb abgesehen, wird beim elektrischen Betrieb die Zugkraft
in ortsfesten Anlagen erzeugt, mittels geeigneter Leitungen dem in Bewegung befind
lichen Triebfahrzeug zugeführt. Die fachwissenschaftliche Behandlung der elektrischen
Zugförderung darf sich daher nicht auf die Behandlung der Fahrzeuge, namentlich der
Triebfahrzeuge beschränken, sie hat vielmehr auch die Stromerzeugung und insbesondere
die Stromzufuhr in den Bereich ihrer Betrachtungen zu ziehen.
Die Stromerzeugung bildet ein für sich abgeschlossenes großes Arbeitsgebiet, und
kann es nicht Sache des Bahningenieurs sein, sich auch mit allen Kleinfragen des Kraft
werkbaues und -betriebes zu befasE~en; es ist daher rliesem Gebiete ein geringer Raum
gewidmet und finden lediglich diejenigen Grundsätze kurze Erörterung, die dem Bahn
ingenieur bekannt sein müssen, um für den Entwurf der Stromerzeugung die Richtlinien
zu geben und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen.
Ohne bei der Behandlung des Stoffes die technisch wis3enschaftliche Grundlage zu
verlassen, ist der mathematische Apparat weitmöglichst eingeschränkt. Dagegen ist
durch systematische Sammlung des Quellenmateriales dafür gesorgt, daß diejenigen, die
sich mit einer besonderen Frage oder mit einem bestimmten Gebiet des elektrischen
Eisenbahnwesens näher befassen wollen - als es im Rahmen eines das ganze Fach
gehlet umfassenden Werkes ohne Einbuße an Übersichtlichkeit des Stoffes möglich ist -
unschwer das in Betracht kommende Schrifttum im "Handbuch" nachgewiesen vorfinden.
Bei dem Umstand, daß der Verfasser vorwiegend im Gebiete der vormaligen öster
reich-ungarischen Monarchie tätig war, läßt sich eine gewisse Einstellung der Betrachtungen
auf die in diesem Lande herrschenden technischen Verhältnisse nicht vermeiden. Mit
Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der gestellten Anforderungen und die bekannter
maßen eisenbahntechnisch schwierigen Verhältnisse in diesem Lande dürfte dieserUmstand
den Wert des Handbuches nicht beeinträchtigen.
In der Art der Behandlung des Stoffes wird die kritische Betrachtung der Be
schreibung gegenüber grundsätzlich bevorzugt, indem auf diese Weise eher zur ingenieur
mäßigen, jede Aufgabe nach ihrem Wesen individuell erfaE"senden Denkungsart an
geregt wird.
Der technischen Denkungsart hat der Verfasser durch Pflege der bildliehen Dar
stellung der mathematischen Zusammenhänge Rechnung zu tragen getrachtet, und aus
diesem Gesichtspunkt auch die nomographischen Rechenverfahren von M. d'Ocagne
in geometrischer Behandlung zur Lösung selbst verwickelter Berechnungen in aus
gedehntem Maße benützt.
Die im Auslande, insbesondere in der Schweiz gewonnenen Erfahrungen im Sonder
gebiete der Bergbahnen sollen durch die Mitarbeit eines iangjährigen Spezialisten in
Vorwort zur zweiten Auflage. V
diesem Fache, Ing. H. H. Peter, Zürich, volle Berücksichtigung finden, Herrn Ing.
Peter sei auch hier für seine Bereitwilligkeit, an den betreffenden Kapiteln des Werkes
mitzuarbeiten, wärmstens gedankt.
Das mühevolle Lesen der Korrekturen besorgte in dankenswerter Weise Dr. Techn.
Alfred Winkler, Wien. Dr. Winkler beteiligte sich auch an der Bearbeitung des
Kapitels betreffend die Gesetze der Erwärmung der Triebmaschinen.
Denjenigen Firmen der elektrischen Industrie, die durch Überlassung von In
formationen und Abbildungen die Arbeit der Verfasser gefördert haben, und der Ver
lagsbuchhandlung Julius Springer, die durch verständnisvolles Eingehen auf die
vielfach ungewöhnliche Fassung des Werkes und durch gediegene Ausstattung den
Verfasser in der Erreichung seines Zieles unterstützt hat, sei auch hier der aufrichtige
Dank ausgesprochen.
Wien, im Dezember 1921.
Dr.-lng. Seefehlner.
Vorwort zur zweiten Auflage.
In erfreulich kurzer Zeit nach dem Erscheinen der ersten Auflage des "Hand
buches" erweist sich die Notwendigkeit einer zweiten Auflage. Aus dieser Tatsache
und aus den Besprechungen, die über das Werk in der Fachliteratur er"chienen sind,
glaubt der Verfasser schließen zu dürfen, daß die Art und das System der Behandlung
des Gegenstandes, sowie die Gliederung des Stoffes in Fachkreisen Beifall gefunden haben.
In diesem Belange erscheint daher die zweite Auflage in grundsätzlich unverän
derter Form.
Der Verfasser beschränkte sich darauf, die seither erzielten belangreichen Fort
schritte und Leistungen der Technik und Wissenschaft auf diesem Gebiete zu berück
sichtigen, die mit Unterstützung wohlwollender Fachkollegen festgestellten Lücken und
Mängel zu beheben und die Behandlung des Stoffes, wo dies als nötig empfunden
wurde, zu vertiefen.
Die Abfassung der Abschnitte: Zahnbahnen, Stand- und Schwebeseilbahnen hat für
die zweite Auflage Ing. H. H. Peter allein besorgt.
Besonderer Dank gebührt Herrn Ing. Rudolf Pfeffer für die äußerst gewissen
hafte Korrektur der zweiten Auflage.
Wien, im Juli 1924.
Dr.-lng. Seefehlner.
Die Neuabfassung der Abschnitte über Zahn- und Seilbahnen nimmt, soweit es
der Handbuchcharakter des Werkes gestattet, auf die Bedürfnisse der Praxis möglichst
Bedacht. Ich habe deshalb nicht nur jüngere Bahnausführungen tunliehst berücksichtigt,
sondern auch einige Ableitungen, wie Längenprofil und Gefällsausrundungen bei Seil
bahnen, entsprechend meiner Vorlesung über Spezialbahnen an der E.T.H. in kürzerer
und brauchbarer Form dargestellt.
Zürich, 1. August 1924.
Dipl.-Ing. H. H. Peter.
Inhaltsverzeichnis.
Erster Teil.
Allgemeines.
Seite
I. Richtlinien der Eisenbahntechnik . . . . . . . 1
II. Systeme der elektrischen Zugförderung . . . . . . 2
III. Vor- und Nachteile der elektrischen Zugförderung . 3
IV. Ausdehnung des elektrischen Vollbahnbetriebes .. 5
V. Allgemeine Kennzeichnung der verschiedenen Bahnarten.
A. Reibungsbahnen.
1. Industriebahnen 6
2. Straßenbahnen 7
3. Lokalbahnen 8
4. Stadtbahnen . 11
5. Vollbahnen .• 14
6. Gleislose Bahnen 20
B. Fahrzeuge mit eigener Kraftquelle.
7. Benzin- (Benzol-, Rohöl-) elektrische Fahrzeuge 21
8. Speicherfahrzeuge . . . . . . . . . . . 22
9. Umformerlokomotiven ..•.......•. 23
C. Spezialbahnen.
10. Zahnbahnen 24
11. Drahtseilbahnen 25
12. Schwebeseilbahnen 26
Zweiter Tei I.
Stromerzeugung.
1. Technisch-wirtschaftliche Grundlagen 28
2. Art der Belastung 31
3. Milderung der Spitzen . . . . . . • 32
4. Kurzschlüese • . • . . . . . . . . 32
5. Mittel für ein elastisches Verhalten . 33
6. Quecksilberdampf-Gleichrichter 37
7. Selbsttätige Umformerwerke • 38
8. Periodenumformer 41
9. Wirtschaftliche Bedeutung des Ausgleiches der Belastung. Pufferung 42
10. Resonanzerscheinungen 44
11. Schaltungsregeln 44
12. Schutzeinrichtungen . . 45
13. Einpolige Erdung . . . 45
14. Strombezug aus bahnfremden Werken 46
Dritter Teil.
Die Leitungsanlage.
Fern- und Speiseleitungen . . • 48
Die Arbeitsleitung (Fahrleitung).
A. Theorie und Berechnung.
I. Elektrische Eigenschaften, Festwerte, Berechnung der Leitungsanlage.
1. Gang der Rechnung • . . . • . • . • • • 49
2. Elektrische Kennwerte der Leitungsanlage . • • . . • • . • 50
Inhaltsverzeichnis. VII
II. Die Stromverteilung. Seite
1. Allgemeines . . . • . . . . . . . . . . . . . 56
2. Berechnung der Stromverteilung . . • . • • . • . 57
UI. Fernwirkungen der Stromzuführung für die Zugförderung.
1. Fernwirkungen . . . . . . . 62
2. Statische Induktion . . . . . 63
3. Elektrodynamische Wirkungen 64
4. Elektromagnetische Induktion 68
IV. Mechanische Eigenschaften.
1. Allgemeines. Systeme • • . . • . . • 70
2. Der Längsschnitt (Durchhangberechnung) 70
Grundgleichungen . • . • . . . . 71
Die Belastung der Leitung . . . . . 75
Die allgemeine Zustandsgleichung • . 76
Zeichnerisches Rechenverfahren zur Lösung der allgemeinen Zustandsgleichung 79
Änderung des Leitungsgewichtes 81
Zahlenbeispiele . . . . . 84
Schiefe Spannfelder . . . . . . 87
Messung des Durchhanges . • . 89
Wahl des Durchhanges für das Tragseil 90
Verschiedene Belastungen in benachbarten Spannfeldern 92
3. Lageplan der Fahrleitung für Rollenstromabnehmer 94
4. Lageplan der Fahrleitung für Bügelstromabnehmer . 95
5. Das Spannwerk • . . . . • . 97
6. Berechnung der Stutzpunkte • 98
Mauerhaken, Rosetten 98
Armausleger 99
Maste • . . . • • . 99
B. Leitungsbau.
V. Der Leitungsbau.
1. Zweck der Fahrleitung 100
a) Die Oberleitung 101
b) Die Stromschiene . 102
c) Die Unterleitung . 102
2. Die selbsttragende Fahrleitung . 102
Der Arbeitsdraht • 102
Querschnittsformen 103
Das Klemmwerk 104
Isolatoren und Isolatorhalter 105
Tragwerk und Stützpunkte • 110
Doppelpolige (Drehstrom·) Fahrleitungen 114
Fahrleitungen in Stollen und Tunnels . 114
3. Fahrleitungen mit Vielfachaufhängung 115
Das ;Einfachkettenwerk 120
Das Verbundkettenwerk . 122
Das Doppelkettenwerk • . 122
Kettenwerk System Paul • 123
Draht- und Seilverbinder 123
Die Isolatoren 126
Streckentrennung, Schaltung, Blitzschutz 131
4. Fahrleitung mit Stromschiene 133
5. Die Unterleitung 137
6. Die Rückleitung . • . . • • 138
Vierter Teil.
Die Fahrzeuge.
Bewegungsgesetze der Züge.
I. Bahnwiderstände.
1. Der Reibungswiderstand . 142
2. Der Luftwiderstand . • • 143
VIII Inhaltsverzeichnis.
Seite
3. Der Hebungswiderstand . . 143
4. Der Krümmungswiderstand 144
5. Die Beschleunigung . . . . 144
6. Analyse der Bewegungsbilder. Wirkung der umlaufenden Massen . 149
7. Ermittelung des Fahrwiderstandes für Straßenbahnfahrzeuge . 155
8. Ermittelung des Fahrwiderstandes mit veränderlichen Werten 156
9. Erfahrungszahlen und -formeln für die Fahrwiderstände 157
10. Schlußfolgerungen für den Lokomotivbau .........• 161
li. Die Zugkraft am Radumfang. Die Fahrgeschwindigkeit.
1. Physikalische Grundlagen. Der Reibungsschluß 161
2. Die Reibungsgrenze • • . . . 164
3. Das angehängte Zugsgewicht. 165
4. Die Form des Radreifens . . 167
5. Der Achsdruck . . . . • . . 168
6. Das spezifische Baugewicht und die Reibungsgeschwindigkeit von Triebfahrzeugen 169
7. Rechentafeln für das Triebfahrzeug . . . 171
·8. Das Gewicht ausgeführter Lokomotiven . 173
9. Die Fahrlinien. Belastungstafeln . . . . 17 4
10. Haltezeiten der Züge . . . • . . . . . 182
11. Fahrgeschwindigkeiten der Zugförderung 182
Die elektrische Ausrüstung der Fahrzeuge.
Ill. Der Bahnmotor.
1. Kennlinien des Bahnmotors . . . . . . . . 185
2. Die Abhängigkeit von der Klemmenspannung 187
3. Die Regelung der Geschwindigkeit 188
4. Das Anlassen . . . . • • . . : . . 189
5. Parallelbetrieb . . . • . . . . . . 190
6. Vergleich mit der Dampflokomotive 192
7. Arten des Einphasenkollektormotors 192
8. Die Stromwendung . . . . . . . . 193
9. Der doppeltgespeiste Reihenschlußmotor 194
10. Df!r Reihenschlußmotor :r1J.it abgezweigter Kompensation 197
11. Gegenüberstellung des Wechselstrom- und Gleichstrommotors 199
12. Gleichstrombetrieb mit Wechselstromeinrichtungen . 199
lV. Die elektrodynamische Bremsung.
1. Arten der elektrodynamischen Bremsun!! 200
2. Die unmittelbare Kurzschlußbremsung . 201
3. Die gemischte Bremsung . . . . . . . 202
4. Die mittelbare elektromagnetische Bremsung 203
5. Die Berechnung der Bremswiderstände 203
6. Bremsschaltungen . . . . . . . . . . 205
7. Die elektromagnetische Solenoidbremse 206
8. Berechnung der Solenoidbremse 207
9. Schaltung der Solenoidbremse 209
10. Die Scheibenbremsen 209
11. Die Schienenbremsen . . . . 210
12. Die Nutzbremsung . . . . . 211
13. Die Nutzbremsung mit Gleichstrommotoren 212
14. Die Nutzbremsung mit Drehstrominduktionsmotoren 214
15. Die Nutzbremsung mit Wechselstromkollektormotoren 214
16. Vergleich der Wirkungsweise der Nutzbremsung bei Gleich- und Wechselstrom 216
V. Die Bemessung der Motorleistung.
1. Grundsätze für die Bemessung der Motoren . . . . . • . . . . . 217
2. Berechnung des Stromverbrauches • . . . . . . . . . . . . . . 218
3. Die Erwärmung und die Abkühlung; ihre Gesetze und Berechnung 221
a) Grundgesetze der Erwärmung • . . 221
b) Eigenschaften der Temperaturkurven .......... . 224
c) Zeichnerische Rechenbehelfe . . . . . . . 226
d) Vereinigung der thermischen und mechanischen Charakteristik 231
.
e) Wärmetechnische Eigenschaften der Maschinen ' 234
f) Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Inhaltsverzeichnis. IX
VI. Die Bauformen des Bahnmotors. Das Getriebe.
Seite
1. Die Bauformen der Triebmaschine 240
2. Verwendungsgebiete ..• 241
3. Der Achsmotor . . . 242
4. Der Vorlegemotor 245
Der Doppelmotor . 250
Gefederte Zahnräder • 251
Mechanische Ankerbeanspruchung . 254
Die Motor-Aufhängung . ·255
Die Kühlung . . . . 255
5. Der Gestellmotor . . • . . 258
6. Das Parallelkurbelgetriebe . 263
a) Das elementare Kurbelgetriebe • 266
b) Die Schlitzkuppelstange • . • . 273
c) Das Parallelkurbelgetriebe mit Blindwelle . '!.77
d) Der Zweistangenantrieb mit Blindwelle . • 281
e) Der Schlitzkuppelrahmen . . . • . . . . 283
7. Die Schüttelschwingungen des massenreichen Parallelkurbelgetriebes . 288
8. Das doppelte Schubkurbelgetriebe 293
9. Das Leutz-Getriebe . . . • . . . . . 299
10. Vereinheitlichung der Triebmaschinen . 301
11. Der Gestellmotor für Einzelantrieb . . 302
12. Stetigkeitsstörungen beim Zahnradgetriebe . 303
13. Grundsätzliche Einteilung und Übersicht der Getriebearten 306
VII. Die Steuerung der Fahrzeuge.
1. Grundgleichung • . . 308
2. Regelarten . 309
3. Arten der Steuerung 310
4. Grundsätze der Schaltregeln 310
5. Fahrschalter für unmittelbare Steuerung 314
6. Schaltung der Widerstände . • . . . . 320
7. Mittelbare Steuerungen . . . . . . . . 321
8. Elektromagnetische Schalter für indirekte Steuerungen 322
9. Die P.C-Steuerung der General Electric Co. 336
10. Stufenlose Steuerung für Gleichstrom 337
11. Stufenlose Steuerung für Wechselstrom 342
12. Steuerung mit Bürstenverschiebung • 343
13. Steuerung mit Zusatztransformator 345
14. Unmittelbare Schaltung . . . . 346
15. Die Zahl der Stufen . . . • . . 346
16. Die Bemessung der Widerstände . 349
17. Steuerung von Drehstromlokomotiven • 349
18. Angaben über ausgeführte Steuerungen 351
VIII. Stromabnehmer.
1. Allgemeines . . . . . . 358
2. Stromabnehmerarten 359
3. Der Rollenstromabnehmer 359
4. Der (Schleif-) Bügelstromabnehmer· . 362
5. Der Walzenstromabnehmer .... 369
6. Stromabnehmer für Unterleitung . 370
7. Stromabnehmer für Stromschiene . 371
8. Isolation der Stromabnehmer 372
IX. Nebeneinrichtungen.
1. Die Drosselspule 373
2. Schmelzsicherungen, Höchststromausschalter . 374
3. Die Beleuchtung 374
4. Die Heizung 375
5. Kupplungen 375
6. Kabel .•• 376
X Inhaltsverzeichnis.
Bauregeln für Triebfahrzeuge mit Reibungsbetrieb.
X. Straßenbahntriebwagen. Seite
1. Bemessung der Wagengröße 379
2. Bauformen . . • . • • • 380
3. Untergestelle . . . . . . 384
4. Wagen mit Mitteleinstieg 387
5. Gewichtangaben 387
6. Die Schutzvorrichtungen . 388
7. Die Bremse ..... . 389
XI. Triebwagen für Stadt- (Untergrund-) Bahnen.
1. Grundlagen für den Entwurf . • . • . 390
2. Grundriß der Wagen .•...... 397
3. Stromzuführung; elektrische .Ausrüstung . 399
XII. Industrielokomotiven.
1. Besondere Kennzeichen . • • 400
2. Zweimotorige .Ausrüstung 404
3. Motoren außerhalb der .Achsen 404
4. Hintereinander-Anordnung der Motoren 404
5. Innenliegende Motoranordnung • 404
6. Drehgestell-Lokomotiven . . • 405
7. Verschublokomotiven 406
8. Einrichtung des Führerstandes 406
XIII. Vollbahnlokomotiven.
1. Benennung der Bauarten auf Grund der Achsfolge . 4Jl
2. Maßbestimmungen •••......• 412
3 . .Anordnung der elektrischen .Ausrüstung . 412
4. Die Mechanik . • • 413
5. Bauformen . . . . 418
6. Lokomotiventwürfe 419
7. Der Rahmen . . . 425
8. Die Kühlung . . . 425
9. Anordnung der Bremse 425
10. Baulängen ausgeführter Lokomotiven 426
11. Angaben über ausgeführte Lokomotiven . 427
XIV. Gleislose Bahnen.
1. .Allgemeines . . . • • . . . . . . 511
2. Die Fahrleitung; die Stromabnehmer 513
3. Stromsystem: Betriebsspannung 515
4. Fahrzeuge . • • . . • . • . . . . 515
XV. Kalorische Fahrzeuge mit elektrischer Kraftübertragung.
1. Allgemeines . . . . . . . • . . . . . . 516
2. Grundsätze. Dampfelektrische Lokomotive 516
3. Diesel- und benzinelektrische Fahrzeuge 518
4. Bauregeln für die fahrbare Triebmaschine 522
5. Bauformen der Triebfahrzeuge 523
6. Die elektrische Ausrüstung 525
XVI. Umformerfahrzeuge (Lokomotiven) 527
XVII. Speicherfahrzeuge . . • . . • . 529
Fünfter Teil.
Spezialbabnen.
I. Zahnbabnen.
1. .Allgemeines 53ß
2. Die Zugkraft 537
3. Der Zahndruck 538
4. Der .Auftrieb • 538
5. Standsicherheit 539
6. Zahnstangensysteme • 545
7. Die Leiterzahnstange (Riggenbach) 546
8. Zahnstange Abt . • . • • . . 547
9. Zahnstange Strub . . . . . . <i47
10. Einfache Lamellen-Zahnstange 548