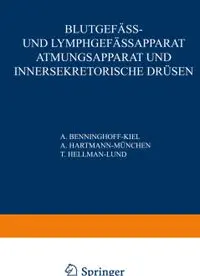Table Of ContentHANDBUCH DER
MIKROSKOPISCHEN ANATOMIE
DES MENSCHEN
BEARBEITET VON
A.BENNINGHOFF· M.BIELSCHOWSKY · S. T.BOK·J.BRODERSEN ·H.v.EGGELING
R. GREVING . G. HA.GGQVIST . A. HARTMANN · R. HEISS • T. HELLMAN
G. HERTWIG · H. HOEPKE · A. JAKOB· W. KOLMER · J. LERNER· A. MAXIMOW t
G. MINGAZZINI t · W. v. MöLLENDORFF ·V. P ATZELT · H. PETERSEN · H. PLENK
W. PFUHL . B. ROMEIS · J. SCHAFFER · G. SCHALTENBRAND . R. SOHRöDER
S. SCHUMACHER · E. SEIFERT· H. SPATZ· H. STIEVE · PH. STöHRJR. · F. K. STUD-
NICKA · E. TSCHOPP · C. VOGT · 0. VOGT · F. WASSERMANN · F. WEIDENREICH
K. W. ZIMMERMANN
HERAUSGEGEBEN VON
WILHELM v. ~IÖLLENDORFJ1_,
FREIBURG r B
SECHSTER BAND
BLUTGEFlSS- UND LYMPHGEF.iSSAPPARAT
ATMUNGSAPPARAT UND INNERSEKRErrORISCHE
DRÜSEN
ERSTER TEIL
BLUTGEFÄSSE UND HERZ . LYMPHGEFÄSSE
UND LYMPHATISCHE ORGANE · MILZ
SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH
1930
BLUTGEFÄ SS-
UND L YMPHGEI--.ÄSSAPPA RAT
ATMUNGSAPPARAT UND
INNERSEKRETORISCHE DRÜSEN
ERSTER TEIL
BLUTGEFÄSSE UND HERZ · LYMPHGEFÄSSE
UND LYMPHATISCHE ORGANE · ~IILZ
BEARBEITET VON
A. BENNINGHOFF -KIEL . A. HARTMANN-MÜNCHEN
T. HELLMAN-LUND
MIT 299 ZUM GROSSEN TEIL FARBIGEN
ABBILDUNGEN
SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH
1930
ALLE RECHTE. INSBESO='IDERE DAS DER UBERSETZUNG
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN
COPYRIGHT 1930 BY SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG
URSPRÜNGLICH ERSCHIENEN BEI JULlUS SPRINGER lN BERLIN 1930.
SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 1ST EDITION 1930
ISBN 978-3-540-01118-7 ISBN 978-3-642-47857-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-47857-4
Inhaltsverzeichnis.
Seite
Blutgefäße und Herz. Von Professor Dr. A. BENNINGHOFF, Kiel. (Mit 156 Abbildungen.)
I. Die erste Entstehung der Gefaße und des Herzens . . . . . . . 1
A. Die extraembryonale Gefäßbildung l
l. Gefäßanlagen bei Tieren . . . . . . . 1
2. Gefäßanlagen beim Menschen. . . . . 3
3. Die Differenzierung der Endothelrohre 5
B. Die Bildung des Herzens und der Gefäße im Embryonalkörper 6
l. Die erste Anlage . . . . . . . . . . 6
2. Die Gefäßsprossung bei geschlossenem Kreislauf 8
C. Entwicklungsmechanik der fruhen Gefaßbildung 12
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II. Die Capillaren . . . . . . . . . . 18
A. Verteilung und Maße der Capillaren 18
B. Der feinere Bau der Capillaren 25
l. Die Endothelien . . 25
2. Das Grundhautehen . . . . 30
3. Die Pericyten . . . . . . 31
4. Die Bedeutung der Pericyten . . . . . . . 35
C. Besondere Bauweisen der Capillarwand und die Reaktionsweisen der Blut-
gefaßendothelien . . . . . . . . 37
l. Capillarwand und Durchlassigkeit 37
2. Die Lebercapillaren . . . . . . 38
3. Capillareu J.er Nel•enniere . . . 40
4. Capillaren J.es Knochenmarkes . 40
5. Capillaren der lymphatischen Organe 40
6. Zellproduktion und Vitalfarbung- 42
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . 45
III. D1e Arterien . . . . . . . . . . . . 49
A. Allgemeines Verhalten der Gewebe der Arterienwand 49
l. Allgemeines . . . . . . . 49
2. Die elastischen Elemente . 49
3. Die glatten Muskelfasern . 51
4. Das Bindegewebe 53
5. Die Media 55
6. Die Intima . . . 58
7. Die Adventitia . . . . . . . . 60
8. Über das Faserkontinuum in der Gcfaßwand 62
B. Ernahrung der Gefaßwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
C. Bemerkungen über die Mechanik des Blutstroms und die Beanspruchung
der Arterienwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D. Über die Beziehung des Baues der Arterienwand zur Beanspruchung 68
E. Bau der Arterien verschiedener Große 69
1. Die kleinen Arterien . 70
a) Die Intima 72
b) Die .Jledia . . . . 74
c) Die Advcntitia . . 75
2. Die mittelgroßen ~~rterien 76
a) Die .Jledia . . . 76
b) Die Intima 78
c) Die Adventitia . 79
3. Die großen Arterit>n 81
a) Das Bauprinzip 81
b) Die Intima der ~~orta 83
c) Die }ledia der ~~orta 85
d) Die Adventitia der Aorta 89
4. Die ubrigen Arterien 8\J
F. DIE' Aorta der Xichtsauger 0 0 m
VI Inhaltsverzeichnis.
Seite
G. Vergleich der verschiedenen Bauweisen der Aorten . . . . . . . . . . 93
H. Über die Zusammenarbeit von glatten Muskelfasern und elastischem Gerüst
in der Arterienwand . . . . . 94
J. Elastizität der Arterienwand 95
K. Arterien von besonderem Bau . 95
1. Arterien des kleinen Kreislaufs 95
2. Gehirnarterien . . . . . . . . . . 97
3. Arterien des Uterus und der Ovarien 100
4. Penisarten . . . . . . . . . . . . 101
5. Nabelarterien . . . . . . . . . . . . 103
L. Verzweigung und Astabgabe der Arterien. . . . . . . . . . . . . 104
M. Besondere Einrichtungen an den Verzweigungsstellen der Arterien bei
Wirbeltieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
N. Arterio-venöse Anastomosen, Glomus coccygeum und Polsterarterien 107
0. Die Histogenese der Arterienwand . . . . . . . . . . . . . . . 112
P. Entwicklungsmechanik der Gefäßwand . . . . . . . . . . . . . 116
Q. Das postembryonale Gefaßwachstum und die Altersveranderungen 117
R. Die anatomische Anpassung an geänderte Fullungszustande 120
S. Transplantation von Gefäßen . . . . . 123
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
IV. Venen . . . . . . . . . . . . . . . . 131
A. Beanspruchung und Leistung der Venen 131
2. Allgemeiner Bauplan der Venen 133
C. Die kleinsten Venen 134
D. Mittelgroße Venen . . . . . . 137
1. Die Intima . . . . . . . . 137
2. Die Media . . . . . . . . 138
3. Die Adventitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4. Die kollagenen Fasersysteme der Venenwand und ihre funktionelle Be-
deutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5. Kurze Beschreibung einzelner Venengebiete dieser Gruppe 140
E. Die großen Venenstamme. . . . . . . . . . . . . . . . . 142
1. Die Hohlvenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2. Die Pfortader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
F. yenenklappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
G. Anderungen des Wandbaues durch Klappen und Astabgange 179
H. Venen von besonderem Bau 150
1. Muskelfreie Venen . . . . . . . . 150
2. Muskelreiche Venen . . . . . . . 151
3. Die Drosselvenen . . . . . . . . 153
4. Venenherzen . . . . . . . . . . 157
5. Turborahnliehe Organe bei Rochen 158
J. Altersveranderungen . 158
Literatur . . . . . . . . . . 158
V. Das Herz . . . . . . . 161
A. Entwicklungsmechanik 161
B. Das Wandendokard . . . . . . . 162
1. Der Aufbau des Wandendokards . . . . . . . 162
2. Die funktionelle Bedeutung des Wandendokards . 168
3. Die morphologische Bedeutung des Wandendokards 170
4. Histogenese des Wandendokards 170
C. Die Herzklappen. . . . . . . 171
1. Die Semilunarklappen . . . 171
2. Die Arterienwurzeln . . . . 175
3. Die Atrioventrikularklappen 177
a) Entwicklung . . . . . . 177
b) Der gewebliche Aufbau . . . . . . . . . 179
c) Besonderheiten der Segelklappen . . . . . 183
4. Die Valvula venae cavae inferioris (Eustachii) 184
5. Die Valvula foraminis ovalis . . . . 185
D. Endokard und Herzklappen bei Tieren 186
E. Das Herzskelet des Menschen 187
F. Das Herzskelet bei Tieren 189
G. Der Herzmuskel . . . . . . 190
H. Das Perimysium internum . 192
Inhaltsverzeichnis. VII
Seite
J. Die Sehnen des Herzmuskels . 192
K. Das Reizleitungssystem . . . . 196
1. Allgemeines . . . . . . . . 198
2. Das Atrioventrikularsystem 198
3. Der Sinusknoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4. Sarkoplasmarische Fasern außerhalb des Reizleitungssystems. 208
5. Das Reizleitungssystem in der Tierreihe . 210
6. Die Entwicklung des Reizleitungssystems 214
L. Das Epikard . . . . . . . . . . . . . . 215
M. Das Perikard . . . . . . . . . . . . . . 217
N. Die Blutgefäße des Herzens ...... . 217
0. Die Venae minimae Thebesii ........... . 223
P. Die Ernährung des Herzens bei niederen Wirbeltieren . 224
Q. Die Lymphgefaße des Herzens . . . . . 224
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 225
Lymphgefäße, Lymphknötehen und Lymphknoten. Von Professor Dr. T. HELLMAN,
Lund. (Mit 83 Abbildungen.) . . . . . . . 233
I. Die Lymphgefäße, die Lymphbahn . . 233
A. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . 233
B. Morphologie . . . . . . . . . . . . . . 237
I. Lymphgefaßstä.mme. Trunci lymphatici . . 237
a) Der Milchbrustgang. Ductus thoracicus. 238
b) Die übrigen Lymphgefäßstämme . 242
2. Die Lymphgefaße im engeren Sinne 244
3. Die Lymphcapillaren 247
4. Lymphscheiden . . . 253
C. Embryologie . . . . . . 255
D. Altersanatomie . . . . . 265
E. Vergleichende Anatomie. 266
F. Physiologie . . . . 271
Literatur . . . . . . . . . 275
II. Die Lymphknötchen und die Lymphknoten . 282
A. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
B. Die Lymphknötchen Die Solitärknötchen. Die Solitarfollikel. Noduli
lymphatici solitarii. Der Lymphonoduli . . . . . . . . . . 292
C. Die Lymphknoten, die Lymphonodi, die Lymphdrüsen, Lymphoglandulae,
Glandulae lymphaticae ...................... 303
1. Allgemeines . . . . . . . . . 303
2. Mm0phologie . . . . . . . . 307
a) Obersicht . . . . . . . . . . . . • 307
b) Das lymphatische Gewebe . . . . . 308
c) Die Lymphbahnen. Die Lymphsinus . . . . . . . . . . . 325
d) Die Sekundarknotchen. Die Keimzentren (FLEMMING). Die Reak-
tionszentren (HELLMAN) . . . . . . . . . . . . . 328
e) Kapsel, Trabekel und Gefaße . . . . . . . . . . . 341
3. Embryologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
4. Altersanatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
5. Die Umbildung der Lymphknoten im postfetalen Leben. 361
6. Der Status lymphaticus . . . . . . . . . . . . . . . 364
7. Vergleichende Anatomie 366
8. Physiologie . . 370
Literatur . . . . . . . . . . . . 381
Die Milz. Von Professor Dr. ADEL:E HARTMANN, Munchen. (Mit 60 Abbildungen.) 397
I. Die Stellung der Milz im Organismus. 397
II. Das Vorkommen der Milz im Tierreich 398
III. Die mikroskopische Struktur der Milz 402
A. Allgemeiner Bau . . . . . . . . . . . 402
B. Stützgewebe. Kapsel und Milzbalken . 404
C. Die Milzpulpa ........... . 416
1. Das Reticulum des Milzparenchyms . 417
a) Zellen des Reticulums . . . . . . 417
b) Fasern des Reticulums . . . . . 422
2. Die freien Zellen des Milzparenchyms 435
VIII Inhaltsverzeichnis.
Seite
a) Lymphoide Zellen (Lymphocyten, Monocyten, Histiocyten ohne
Merkmal von Speicherung, indifferente Stammzellen . . . 436
b) Granulocyten (neutrophile, acidophile, basophile Leukocyten) 448
c) Erythrocyten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
d) Megakaryocyten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
e) Phagocyten und speichernde Zellen (Reticulo-Endothel) 463
f) Pigmentierte Zellen; Ablagerung von Pigmenten und Eisen 473
g) Lipoidhaltige Zellen; Ablagerung von Lipoiden . . . . . 480
h) Ablagerungen von Glykogen . . . . . . . . . . . . . . 482
i) Oxydasereaktion der Milzelemente . . . . . . . . . . . . . 482
3. Die Verteilung und relativen Beziehungen von roten und._w eißen Milz-
pulpa . . . . . . . . . . . . 484
D. Die Gefaße der Milz . . . . . . . 489
1. Der feinere Bau der Balkengefaße. 490
a) Arterien . . . . . . . . . . . 490
b) Venen . . . . . . . . . . . . 492
2. Der feinere Bau der Pulpagefaße . 492
a) Arterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Arterien der weißen und roten Pulpa 493. - Hulsenarterien
496. - Endigungen der arteriellen Capillaren 508.
b) Venen der Pulpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Capillare Venensinus 510.- Die eigentlichen Pulpavenen 528.
3. Lymphgefaße der Milz . . . . . . . . . . . . . . 529
IV. Die Entwicklung der Milz . . . . . . . . . . . . . 529
V. Beziehungen, die sich aus dem Bau der Milz fur ihre Funktion
ergeben. . . . 540
Literatur . . . . . . . 551
Namen Verzeichnis. 564
Sachverzeichnis .. 578
Berichtigungen.
Seite 13 Zeile 14 von oben lies: LEBERT statt LEBER.
16 16 FINLEY FINEY.
" " " "
46 17 unten WAKEFJELD statt WACKZEFIELD.
" "
59 7 oben V OIGT statt VomTs.
" " "
83 14 VoiGT statt VomTs.
" " "
228 16 His JR., W. statt His, W. JUN.
" " " " "
278 8 His JR., W. statt His, W.
" " " "
283 10 BuscH statt BuRcH.
" "
Blutgefäße und Herz.
Von A. BENNINGHOFF, Kiel.
Mit 156 Abbildungen.
I. Die erste Entstehung der Gefäße und des Herzens.
Bei der Entwicklung des Herzens und der Gefäße betrachten wir im wesent-
lichen die histogenetischen Vorgänge und gliedern den Stoff in drei Teile: den
ersten, der die erste Anlage des Gefäßsystems behandelt, den zweiten, der die
Weiterbildung der Gefäße auf der Grundlage eines geschlossenen Kreislaufs
betrifft, und den dritten, der die Ausbildung der akzessorischen Hüllen der
Endothelröhren zum Gegenstand hat. Der dritte Abschnitt wird bei der Unter-
suchung der ausgebildeten Gefäße bzw. des Herzens eingefügt.
A. Die extraembryonale Gefäßbildung.
1. Gefäßanlagen bei Tieren.
Vor dem Auftreten des Netzes der Endothelröhren finden sich an der Ober-
fläche des Dotters wandungslose, Plasma führende Rinnen. Sie sind bisher
sowohl bei Anamniern ( Petromyzon, Selachier, Teleostier, Amphibien) als auch
bei Säugetieren [Fledermaus, VAN DER STRICHT (1899)), Schaf [BONNET (1891))
und neuerdings beim Hühnchen [SABIN (1920)] gefunden worden. Ihr Inhalt
soll durch einen Sekretionsvorgang von den Entoblastzellen gebildet werden
(VAN DER STRICHT). Man kann diese Kanäle als ein vorläufiges und primitives
Gefäßsystem auffassen, das den bei Wirbeltieren vorkommenden wandungs-
losen Blutlakunen entspricht [LANG (1902), KEISER (1914)] und die Ver-
teilung von ernahrender Flüssigkeit auf der Dotteroberfläche besorgt. Möglicher-
weise sind diese Rinnen wechselnde und vergängliche Bildungen, die an einer
Stelle vergehen und an anderer neu entstehen. Beim Hühnchen beobachtete
SABIN (1920) diese Gruben an der lebenden Keimscheibe und sah, daß sie ihre
Gestalt wechseln und für einige Minuten sogar verschwinden können. Trotzdem
ist es von größtem Interesse, daß mindestens ein Teil dieser Flüssigkeitsbahnen
den spateren Endothelröhren zur Leitbahn dienen soll [RücKERT (1906), VAN
DER STRICHT (1899)]. Man könnte daraus schließen, daß entweder die Rinnen
als solche oder ihr Inhalt die Ansiedlung der gefaßbildenden Zellen begünstigen.
Es wäre demnach das Gefäßnetz des Dotters von diesen primitiven Kanälen
in seiner räumlichen Verteilung zum Teil abhängig.
Die Frage nach der Herkunft der Gefäßendothelien bietet für die Darstellung
große Schwierigkeiten, insofern ihre Ableitung von den Keimblättern noch
nicht geklart ist. Bei dieser Sachlage könnte der Gegenstand nur durch eine
ausführliche Besprechung dargestellt werden. Da das an dieser Stelle untunlich
ist, müssen wir uns darauf beschranken, einige Hauptpunkte herauszugreifen
und im übrigen auf die letzte zusammenfassende Bearbeitung von RucKERT
und MoLLIER (1906) verweisen. Die Literatur, die seit dieser Zeit erschienen ist,
Handbuch der mikroskop. Anatomie Yl/1. 1
2 A. BENNINGHOFF: Blutgefäße und Herz.
wird durch die folgende Darstellung in der gebotenen Kürze besonders berück-
sichtigt.
Die Unsicherheit, die noch über die erste Entwicklung der Gefäßanlagen
herrscht, scheint zwei Ursachen zu haben. Die. erste besteht in der Schwierigkeit
einer sicheren Beobachtung des Vorganges. Die Untersuchung von Schnittserien
kann nicht allein entscheiden, da sie über die Zellbewegungen keinen sicheren
Aufschluß gibt, und Beobachtungen an lebenden Keimscheiben sind noch zu
gering an Zahl. Dazu kommt als zweite Ursache, daß die Herkunft des Meso-
blastes selbst noch keineswegs bei allen Wirbeltieren restlos geklärt ist.
Von RücKERT (1906) ist die Ansicht vertreten und begründet worden, daß
der "ventrale" Mesoblast, der von der gleichnamigen Urmundlippe bzw. dem
ihm entsprechenden Gebiet des Primitivstreifens ausgeht, für die Entwicklung
dieser Anlagen die größte Bedeutung hat. Dieser ventrale Mesoblast zeichnet
sich durch seine mehr oder weniger innigen Beziehungen zum Entoblast aus,
und hierin ist ein Teil der Schwierigkeiten zu suchen, die einer Entscheidung
über die Herkunft der Gefäßanlagen entgegenstehen.
Fassen wir zunächst den Ort der ersten Gefäßanlagen, den außerembryo-
nalen Bezirk der Keimblätter (bei Selachiern, Sauropsiden und Säugern) ins
Auge, so wird neuerdings von RucKERT (1922) wiederum betont, daß die ersten
Blutanlagen schon innerhalb des primären Entoblasten kenntlich sind (Torpedo),
und daß diese Tatsache von allen jenen Forschern nicht beachtet wurde, die die
Anlagen aus dem Mesoblasten herleiten. Zu dieser Zeit ist der periphere Meso-
blast vom Dotterentoblast noch nicht abgespalten. Mit der Deiamination dieses
Mesoblasten gelangen die jungen Blutanlagen in diesen hinein. Hier aber ver-
bleiben sie auch nur vorübergehend, indem der Mesoblast sich am oberen Umfang
von ihnen abtrennt. Sie erscheinen dann zwischen Entoblast und Mesoblast
an einer Stelle, wo die übliche Beschreibung sie als Blutinseln zuerst auftreten
läßt. Es ist bemerkenswert, daß diese Bildungsweise einen Zustand zur Voraus-
setzung hat, bei dem einmal vor einem abgrenzenden Mesoblasten noch nicht
gesprochen werden kann, und andererseits der an diesen Stellen verdickte
Entoblast auch als primärer und nicht definitiver Entoblast zu bezeichnen ist.
Hat hingegen der Mesoblast sich schärfer abgegrenzt, so kommt bei Selachiern
nur noch ein Nachschub in Gestalt von Entoblastknospen in Frage. Es hängt
offenbar von dem Ausbildungszustand des Mesoblast ab, wie weit eine Be-
teiligung des Dotters erkennbar wird, und so kommt alles auf den Ort und die
Zeit an, in der die Gefäßanlagen entdeckt werden. In einem frühzeitig ent-
standenen, also schon gut abgegrenzten Mesoblast können die Gefäßanlagen
erst verspätet kenntlich werden, so daß dem Anscheine nach eine rein mesoder-
male Entstehung vorliegt. Indem diese verschiedenen Erscheinungsformen des
Mesoblastsund der Gefäßanlagen nicht nur bei ein und demselben Keim, sondern
auch bei verschiedenen Tieren wechseln können, entstehen verschiedene Bilder.
Trotzdem werden die Gefäßanlagen auch direkt vom Mesenchym hergeleitet
[MAXIMOW (1909) bei Säugern und DANTSCHAKOFF (1908 bei Vögeln)], indem
die Gefäßbildung als Teilerscheinung der Mesenchymentwicklung aufgefaßt wird
(vgl. hierzu das Kapitel "Das Mesenchym als Quelle der verschiedenen Arten
der Bindesubstanzen" von MAXIMOW. Dieses Handbuch Bd. 2, S. 233-241).
Eine besondere Auffassung wird in der Angioblasttheorie von His (1900)
vertreten, nach der die frühesten Gefäßanlagen eine selbständige Bildung
spezifischer Art darstellen, die in der weiteren Ausbildung vom Mesoblast
unabhängig seien [vgl. auch MINOT (1911) und FINLEY (1922)]. Dieser Teil
der Angioblasttheorie ist meines Erachtens bis heute nicht widerlegt, wie
MAXIMOW meint.