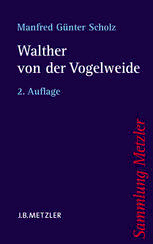
Walther von der Vogelweide PDF
Preview Walther von der Vogelweide
~ J.B.METZLER II Sammlung Metzler Band 316 III Manfred Günter Scholz Walther von der Vogelweide 2., korrigierte und bibliographisch ergänzte Aufl age Verlag J.B. Metzler Stuttgart · Weimar IV Der Autor Manfred Günter Scholz, geb. 1938; Professor i.R. für Ältere deutsche Sprache und Literatur an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen; Veröffent lichungen hauptsächlich zur Rezeption mittelalterlicher Literatur, zu ihren Gönnern und ihrem Publikum, zu Hartmann von Aue (Edition, Kommentar) sowie zu Walther von der Vogelweide. Bibliografi sche Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. ISBN 13: 978-3-476-12316-9 ISBN 978-3-476-05084-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-476-05084-7 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer- tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset- zungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni- schen Systemen. © 2005 Springer-Verlag GmbH Deutschland Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2005 www.metzlerverlag.de [email protected] V Vorwort Dieser Band unterscheidet sich von seinem Vorgänger, Kurt Herbert Halbachs erstmals 1965 in der Sammlung Metzler erschienener Wal ther- Darstellung, grundlegend. Er hat sich zum Ziel gesetzt, lesbarer zu sein, bezahlt diesen Anspruch aber mit dem weitgehenden Verzicht auf die Beigabe der von Halbach in jahrzehntelanger Beschäftigung mit Walther erarbeiteten detaillierten Ergebnisse und Hypothesen der älteren For- schungsgeschichte. Diese Vorgehensweise bedeutet alles andere als Gering- schätzung der früheren Forschung, vielmehr sollten, will man einen ver- läßlichen Gesamtüberblick gewinnen, beide Studien, die vorliegende und die Halbachs, komplementär gelesen werden. Da die Walther-Philologie in den letzten Jahrzehnten Bedeutendes geleistet hat, da neue Editionen vorliegen, die einem gewandelten textkritischen Konzept Rechnung tra- gen, und da auf dem Gebiet der Interpretation in mancher Hinsicht ein Paradigmenwechsel zu beobachten ist, scheint die Konzentration auf die neuere Forschung legitim. Der Band sei, aus Hochachtung für ein Walther gewidmetes Forscher- leben, dem Andenken Kurt Herbert Halbachs gewidmet. Allen, die Vorarbeiten geleistet und mich bei der Redaktion unter- stützt haben, möchte ich herzlich danken. Tübingen, im Februar 1999 M. G. Sch. VII Inhalt I. Walthers Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1. Heimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1 Jugendheimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.2 Geburtsheimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3. Stand und Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3.1 Walthers Lebenszeugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3.2 Ein zweites Lebenszeugnis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4. Lebensstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 5. Lehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 6. Grab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 II. Walthers Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.1 Ton – Lied – Sangspruch – Gattungs- interferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1.2 Überlieferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 1.3 ›Echt‹ – ›Zweifelhaft‹ – ›Unecht‹ . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.4 Metrik und Strophik. Formkunst . . . . . . . . . . . . . . . .31 1.5 Melodien – Walther als Musiker . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. Sangspruchdichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2.1 Einführendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2.2 Walther und die Sangspruch-Tradition . . . . . . . . . . .41 2.3 Walthers Anfänge als Sangspruchdichter. Die ersten Töne in Wien und unter Philipp von Schwaben . . . .42 2.3.1 Zu den politischen Ereignissen im Reich und in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 2.3.2 Der Reichston 8,4ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2.3.3 Der 1. Philippston 18,29ff. . . . . . . . . . . . . . . . . .54 2.3.4 Der Wiener Hofton 20,16ff. . . . . . . . . . . . . . . . .61 2.4 Weitere Töne um König Philipp, Hermann von Thüringen und Leopold VI. von Österreich . . . .66 2.4.1 Der 2. Philippston 16,36ff. . . . . . . . . . . . . . . . . .66 2.4.2 Der 1. Atze-Ton 103,13ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 2.4.3 Der 2. Atze-Ton (Leopoldston) 82,11ff. . . . . . . . . .70 2.4.4 Fragen zu Walthers Weg zwischen drei Höfen . . . . .73 2.5 Zu den politischen Ereignissen seit König Philipps Tod bis zum Niedergang Kaiser Ottos . . . . .74 VIII Inhaltsverzeichnis 2.6 Die Töne für Kaiser Otto (und für/gegen Markgraf Dietrich von Meißen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 2.6.1 Der Ottenton 11,6ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 2.6.2 Der Meißnerton 105,13ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 2.6.3 Der Unmutston 31,13ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 2.7 Die Töne für König und Kaiser Friedrich II. . . . . . . .84 2.7.1 Zum politischen Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . .84 2.7.2 Der König-Friedrichs-Ton 26,3ff. . . . . . . . . . . . . .85 2.7.3 Der Kaiser-Friedrichs-(und Engelbrechts-)Ton 10,1ff. und 84,14ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 2.8 Die übrigen Töne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 2.8.1 Der Rügeton (König-Heinrichs-Ton) 101,23ff. . . . .90 2.8.2 Der Bognerton 78,24ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 2.8.3 Einzelstrophen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 3. Minnesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 3.1 Was ist Minne? Hohe, niedere, rechte und falsche Minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 3.1.1 46,32ff. – ein Programmlied? . . . . . . . . . . . . . . . .97 3.1.2 Frau Minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 3.1.3 Die Forderung nach Gegenseitigkeit . . . . . . . . . .102 3.1.4 69,1ff.: Saget mir ieman, waz ist minne? . . . . . . . .103 3.2 Minne und Zustand der Gesellschaft . . . . . . . . . . . .104 3.3 Walthers frouwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 3.3.1 Schönheit und Tugenden der Frau . . . . . . . . . . .111 3.3.2 Schönheitspreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 3.4 Die Lieder der herzeliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 3.5 Die ›Mädchenlieder‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 3.6 Die Reinmar-Fehde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 3.7 Andere sängerische Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . .142 3.7.1 Walther und Morungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 3.7.2 Walther und Rubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 3.7.3 Walther und Wolfram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 3.7.4 Walther und Neidhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 3.7.5 Walther und Ulrich von Singenberg . . . . . . . . . .146 3.8 Andere Walther-Lieder in der neueren Forschung . . .147 4. Religiöse Lyrik und ›Alterslieder‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 4.1 Lieder der Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 4.1.1 116,33ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 4.1.2 59,37ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 4.1.3 Die Weltabsage 100,24ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 4.1.4 57,23ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 4.1.5 41,13ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 4.1.6 Der Alterston 66,21ff. (67,20ff.) . . . . . . . . . . . . .156 Inhaltsverzeichnis IX 4.1.7 122,24ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 4.2 Lieder vom Kreuzzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 4.2.1 Die Aufforderung zum Kreuzzug 13,5ff. . . . . . . .160 4.2.2 Das Kreuzlied 76,22ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 4.2.3 Das Palästinalied 14,38ff. . . . . . . . . . . . . . . . . .163 4.2.4 Die Elegie 124,1ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 4.3 Der Leich 3,1ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 III. Skizze der Walther-Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 1. Rezeption bis zum Meistergesang . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 2. Vorwissenschaftliche Rezeption in der Neuzeit . . . . . . . .173 3. Wissenschaftliche Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 4. Walther-Ideologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 5. Produktive Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 IV. Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 1. Bibliographien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 2. Ausgaben, Übersetzungen, Faksimiles . . . . . . . . . . . . . . .179 3. Handbücher, Gesamtdarstellungen, Kommentare, Nachschlagewerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 4. Forschungsliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Register der Töne-Namen, der Töne und der Sangspruch-Strophen Walthers nach Lachmanns Zählung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 1 I. Walthers Leben 1. Heimat 1.1 Jugendheimat Mit Recht hat Halbach (1965, S. 8f.) dem Abschnitt »Geburtshei- mat« den zur »Jugend-Heimat« vorangestellt, finden sich in Wal- thers Werk doch einige wenige Ich-Aussagen, die sich auf diese be- ziehen lassen könnten, aber keine einzige, die über seine Herkunft Aufschluß gäbe. Als Walther sich gegen die neue, unhöfische Mode, hêrren guot und wîbes gruoz zu erwerben, zur Wehr setzen zu müssen glaubt, beklagt er sich zuallererst bei Herzog Leopold, mit der Be- gründung: ze Œsterrîch lernde ich singen unde sagen (32,14; alle Zita- te nach Cormeau 1996). Und im Rückblick auf sein Leben muß er sich fragen, ob dieses ein Traum war, ob er aus einem langen Schlaf erwacht ist, denn fremd sind ihm geworden liute und lant, dar inn ich von kinde bin erzogen (124,7; der Reim und der Sinn verlangen diese Konjektur Lachmanns gegen den Wortlaut bin geborn der bei- den Handschriften). Wieder dürfte Österreich gemeint sein, denn die Elegie, aus der dieser Vers stammt, ist im ›österreichischen‹ Me- trum der Nibelungen- und Kürenberger-Langzeile (dazu s.u. S. 167f.) geschrieben. Vom Kontext her und durch die Erwähnung Leopolds mit der erstgenannten Stelle verwandt, wenn auch durch die wir-Formulierung (in der das Ich sich mit der ritterschaft zusam- menschließt) vielleicht von schwächerem Zeugniswert ist der Ausruf wol ûf mit mir, und vare wir dâ heim in Osterrîche! (XXIX,7; Cor- meau 1996, S. 58). Eine letzte Stelle dagegen muß aus der Beleg- sammlung für Walthers (Jugend-)Heimat ausscheiden, die von unser heimlichen (d.h. einheimischen) fürsten (84,20), da man sie sich wohl vom varnden volk (84,18) und nicht vom Ich der Strophe ge- sprochen zu denken hat (s.u. S. 88f.). Walthers Affinität zu Öster- reich bezeugen schließlich ein Sangspruch, in dem er an den Tod des Herzogs Friedrich erinnert (19,29ff.), den man als seinen ersten Gönner vermuten darf, und die Inständigkeit und Ausdauer, mit der er immer wieder um die Gunst des Wiener Hofes wirbt. – Öster- reich also scheint durch diese Zeugnisse faßbar zu werden als das Land, in dem Walther von Kind an gelebt, Erziehung und künstleri- sche Ausbildung genossen hat, das Land, das ihm zur Heimat ge- worden ist, wenn es nicht von Anfang an seine Heimat war.
