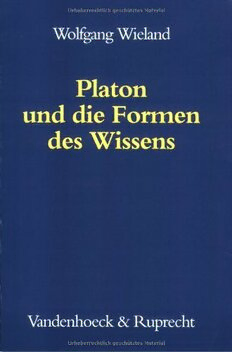
Platon und die Formen des Wissens PDF
Preview Platon und die Formen des Wissens
Wolfgang Wieland Platon und die Formen des Wissens 2., durchgesehene und um einen Anhang und ein Nachwort erweiterte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Universlöad de N"'V,.Hr"", Servicio de Bibliotecas • • 12.0083932 r Inhalt Einleitung ........................................... . 7 Erstes Kapitel: Das geschriebene Werk ...................... . 13 § 1: Platons Schriftkritk ............................. . 13 § 2: Geschriebene und ungeschriebene Lehren ............. . 38 § 3: Der Dialog als Medium des philosophischen Gedankens .. . 50 ! § 4: Formtypen des Dialogs ........................... . 70 • § 5: Platons Entwicklung und die fiktive Chronologie der Dia- loge ......................................... . 83 Zweites Kapitel: Die Ideen und ihre Funktion ................ . 95 § 6: Zum Problem der Ideenlehre ...................... . 95 § 7: Die Kritik derideeniehre ......................... . 105 § 8: Ideen ohne Ideenlehre ........................... . 125 § 9: Idee und Hypothese ............................. . 150 § 10: Die Idee des Guten und ihre Funktionen .............. . 159 § 11: Die Ambivalenzen im Bereich der Normen und die Einheit der Tugend ................................... . 185 § 12: Beiträge zur Deutung der drei Gleichnisse ............ . 196 Drittes Kapitel: Formen des Wissens ........................ 224 § 13: Propositionales und nichtpropositionales Wissen ........ 224 § 14: Das Wissen und der Wissende ..................... " 236 § 15: Technisches und praktisches Wissen .................. 252 Die Deutsche Bibliothek -CIP-Kurztitelaufnahme § 16: Der irrende Wille und die Teleologie des Handelns . . . . . .. 263 Wieland, Wolfgang : § 17: Wissen und Meinung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280 Platon und die Formen des Wissens / Wolfgang Wieland. - § 18: Reflexive Strukturen in Wissen und Handeln ........... 309 2., durchges. und um einen Anh. und ein Nachw. erw. Auf!. - Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1999 Abschluß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 323 ISBN 3-525-30133-2 Anhang .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 326 Nachwort zur Neuauflage ............................... 331 © 1999, 1982 Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich Literaturverzeichnis .................................... 343 aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim Stellenverzeichnis ...................................... 346 mung des Verlages unzulässig 1llld strafbar. Das gilt insbesondere für Griechische Ausdrücke .................................. 352 Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Ein speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Gesamther- Sachregister .......................................... 354 stellung: Hubert & Co., Göttingen Einleitung Resultate philosophischen Nachdenkens sind für uns zumeist in Gestalt von Texten greifbar. Man hat sich daran gewöhnt, dies als eine keiner weiteren Reflexion bedürftige Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Wer einen Weg zum philosophischen Denken sucht, steht vor der Notwendig keit, bestimmte Texte zu studieren; wer philosophisches Denken prakti ziert, wird in aller Regel bestrebt sein, den Resultaten dieses Denkens die Gestalt von Texten oder zumindest die Gestalt von textfähigen Gebilden zu geben. Manchmal mag es sogar scheinen, als erreiche der philosophische Gedanke erst dann seine optimale Ausformung, wenn er in einem Text fixiert und damit zugleich mitteilbar gemacht wird. Erst dann kann man mit ihm, wie es scheint, als mit einem identifizierbaren Gebilde umgehen. Es ist jedenfalls eine Tatsache, daß das Studium der Philosophie zumeist am Leitfaden der Beschäftigung mit Texten absolviert wird. Darin unterschei den sich die einzelnen Schulen und Richtungen der Philosophie nur wenig. Texte sind auch die Bezugsgrößen, an denen sich Kontroversen und Kon sense in gleicher Weise orientieren. Die Prüfung eines philosophischen Gedankens hat daher auch fast immer eine in einem Text fixierte oder zumindest fixierbare Gestaltung dieses Gedankens zum unmittelbaren Ge genstand. Freilich hat die Philosophie von alters her immer wieder auch mit der Möglichkeit von Einsichten gerechnet, die aus prinzipiellen Gründen nicht in diskursiver Gestalt dargestellt und mitgeteilt werden können und die aus diesem Grunde auch nicht textfähig sind. Das Selbstverständnis der Phi losophie im Hinblick auf die Struktur und die Eigenart ihrer Arbeit ist jedoch durch das Bewußtsein von dieser Möglichkeit, entgegen dem äuße fen Anschein, nur 'wenig beeinflußt worden. Denn wo immer sie sich auch veranlafst sah, die Möglichkeit von prinzipiell nicht texttähigen Einsichten einzuräumen, - sie konnte zumindest diese Möglichkeit als solche zum Gegenstand diskursiver Erörterungen machen. In der Tat kann man sich jederzeit auf eine Reflexionsstufe begeben, auf der man den Anspruch auf universale Diskursivität erheben und durchsetzen kann. Denn vom Philoso phierenden, der sich auf einer solchen Stufe befindet, erwartet niemand mehr, daß er selbst Evidenzen oder Intuitionen realisiert. Man erwartet von ihm nur, daß er über derartige Formen nichtdiskursiven Erkennens begründbare Aussagen macht und daß er die Richtigkeit dieser Aussagen auch zu verteidigen bereit ist. So mag es scheinen, als bedürfte es nur einer 8 Einleitung Einleitung 9 hinreichend entwickelten Reflexionsfähigkeit, wenn es darum geht, alle die Sache des literarischen Textes ist eine Funktion dieses Textes selbst. Sie Versuche abzuwehren, die darauf zielen, die Philosophie aus dem Zauber wird von ihm allererst entworfen und existiert nicht unabhängig von ihm. kreis der Texte hinauszuführen. Philosophische Texte sind ihrem Status nach nun freilich keine literari Niemand wird den Gewinn preisgeben wollen, der dem philosophischen ,s,henTexte, Gleichwohl geht man nicht selten mit ihnen so -um, als Gedanken dadnrch zuwächst, daß er sich an Texte bindet, in denen er sich handelte es sich um literarische Texte. Das ist beispielsweise überall dort zu objektivieren vermag. Diese Bindung ist dnrch die philosophischen der Fall, wo man mit der Philosophi, wie mit einer Art von Begriffsdich Bemühungen der Gegenwart noch enger geworden, als sie es ohnehin schon tUJ1g, wie mit dem bloßen Ausdruck von Weltanschauungen oder Lebens war. Die Behandlung philosophischer Texte mit Hilfe von philologischen gefühlen umgeht, gleichgültig, ob man sich dabei dieser Ausdrücke bedient und vor allem mit logisch-analytischen Methoden hat Möglichkeiten eröff oder nicht.' Aber auch dort, wo man der Philosophie nur die Aufgabe net, die der Entwicklung und der Differenzierung der philosophischen zugesteht, Modelle zu entwerfen, die für die Orientierung innerhalb der Problematik selbst zugute gekommen sind. Das gleiche gilt von den Mög Welt die Funktion von nützlichen Werkzeugen übernehmen können, gibt es lichkeiten, die durch die Entwicklung von Kunstsprachen eröffnet worden keine Sache, die von der Philosophie und ihren Aussagen nur dargestellt sind. Auf diese Weise sind Standards hinsichtlich der möglichen Klarheit würde und die sich auch unabhängig von den einschlägigen Texten präsen und der Präzision der Aussage entwickelt worden, die die Philosophie tieren ließe. Gerade ein zu seinem Zweck taugliches Werkzeug verhält sich schwerlich außer acht lassen kann, wenn sie sich selbst ernst nimmt. nicht in der Weise der Abbildung oder der Darstellung zu dem Gegenstand, Dennoch ist es bedenklich, wenn man die Bindung des philosophischen an dem es sich bewährt. Doch was die Sache der Philosophie eigentlich ist, Geäankens an Texte und textfähige Gebilde als etwas Selbstverständliches läßt sich nun einmal nicht außerhalb ihrer bestimmen. Daher kann man ansieht. Denn man macht sich in diesem Fall gar nicht mehr klar, von auch nicht gleichsam vorweg angeben, in welcher Weise sich der philoso welcher Art eigentlich die Sache ist, auf die sich der Text bezieht und in phische Text auf die von ihm intendierte Sache bezieht, ob er diese Sache welcher Weise er sich auf sie bezieht. Der Philosophiebeflissene hat zudem darzustellen und abzubilden oder ob er sie allererst zu entwerfen sucht. zu den Texten als solchen zumeist eine naive Einstellung. Es ist eine Man darf noch nicht einmal von der Annahme ausgehen, daß diese Einstellung, zu der auch das Vertrauen gehört, daß sich der Text auf eine Alteruative vollständig ist. Schon der semantische Status philosophischer von ihm selbst verschiedene, identifizierbare Sache bezieht und deswegen Text.e gibt daher Probleme auf, die als solche noch kaum bekannt sind. Einsichten in diese Sache sowohl verkörpern als auch vermitteln kann. Der Zum Glück ist es aber gar nicht unbedingt nötig, die Frage nach der Umgang mit dem Text wird in diesem Falle von der Überzeugung geleitet, Sache der Philosophie vorweg zu beantworten, weun man mit philosophi daß die Kenntnis und das Verständnis des Textes die Chance eröffnet, schen Texten auf angemessene Weise umgehen will. Das gilt nicht nur im Einsicht in die Sache zu gewinnen, auf die er sich bezieht. Hinblick darauf, daß man den Text zum Gegenstand von Untersuchungen Eine derartige Einstellung läßt sich angesichts der Texte aus dem Bereich machen kann, die sich historischer oder philologischer, psychologischer der alltäglichen Lebenspraxis ebenso gefahrlos kultivieren wie angesichts oder soziologischer Methoden bedienen. Es gilt selbst im Hinblick auf die der meisten wissenschaftlichen Texte. Schwierigkeiten ergeben sich indes Tatsache, daß man ckn_Wahrheitsal1spruch ernst nehmen kann, der mit sen, sobald man es mit philosophischen Texten zu tun hat. Denn was die den meisten philosophischen Texten, die wir kennen, verbunden ist. Denn Sache der Philosophie überhaupt sei, ist eine nichttriviale Frage, deren in philosophischen Texten werden nun einmal zumeist Aussagen formu Erörterung bereits in den Innenbereich der Philosophie gehört. Alle For liert, mitgeteilt und begründet, für deren Wahrheit sich ihr Autor stark meln, mit deren Hilfe man den Aufgabenbereich der Philosophie zu macht. Wie die Sache der Philosophie auch strukturiert sein mag, - der umschreiben pflegt, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß hier eine Autor eines philosophischen Textes der üblichen Art verbindet mit seinen nicht leicht zu überwindende Schwierigkeit liegt. Geht es um Texte, so stellt Aussagen jedenfalls den Anspruch, diese Sache zu treffen. der Gebrauchstext der alltäglichen Lebenspraxis den einen Grenzfall dar. Auch ein philosophischer Text bietet natürlich viele Aspekte, denen man Bei ihm darf man regelmäßig davon ausgehen, daß die Sache von dem Text, auch dann gerecht werden kann, wenn man von diesem Wahrheitsan der sich auf sie bezieht, prinzipiell unabhängig ist und daher grundsätzlich spruch absieht. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man mit Hilfe der auch immer unabhängig vom Text präsentiert werden kann. In diesem "ben erwähnten Methoden 4en Text als solchenauf gegenständlicheWeise Bereich besteht daher immer auch die prinzipielle Möglichkeit eines text lllltersucht. In seiner Eigenschaft als philosophischer Text nimmt man ihn i " freien Zugangs zu den Sachen, von denen der Text handelt. Den anderen jedoch erst dann ernst, wenn man auf seinen Wahrheits anspruch eingeht. Grenzfall bildet der literarische Text. Hier gibt es gar keine Sache, zu der Auf diese Weise ist die philosophische Interpretation eines einschlägigen man sich einen Zugang unabhängig vom Text verschaffen könnte. Denn Textes von philologischen oder historischen Interpretationen untetschie- 10 Einleitung Einleitung 11 den. Wer auf den Wahrheitsanspruch eingeht, ist nicht verpflichtet, diesen geben, die sich ihr Autor selbst noch gar nicht gestellt hat und die er sich Anspruch zu akzeptieren. Im Gegenteil: Gerade wer diesen Anspruch ernst von seinen Voraussetzungen aus auch noch gar nicht stellen konnte. Darin nimmt, wird ihm gegenüber skeptisch sein müssen. Denn er muß prüfen, ob zeigt sich gleichsam ein hermeneutischer Überschuß des klassischen Textes. der Anspruch legitimerweise erhoben wird und ob er eingelöst werden Er macht verständlich, warum die klassischen Texte der Philosophie nicht kann. Der Interpret kann sich in diesem Falle nicht darauf beschränken, veralten, sondern unter der Voraussetzung neuer Methoden und Fragestel gleichsam als neutraler Beobachter Aussagen über den Autor und seinen lungen auch selbst immer wieder in einem neuen Licht erscheinen und die Text zu machen. Er muß sich auch selbst auf die Ebene begeben, auf der der Erkenntnis der Sache fördern können. Autor seine Überlegungen anstellt; er muß in diese Überlegungen eintreten Es versteht sich von selbst, daß das Gesagte in besonderem Maße auch und sie weiterentwickeln können. In diesem Fall ist der Autor Gegenstand für Platon und sein Werk gilt'. Trotzdem nimmt Platon in Hinblick auf die der Untersuchung, zugleich aber auch Partner einer an einer gemeinsamen hier erwähnten Probleme eine Sonderstellung gegenüber fast allen anderen Sache orientierten Auseinandersetzung. Autoren im Umkreis der Philosophie ein. Die meisten Autoren zeigen Nur wenn man eine derartige Einstellung realisiert, ist es möglich, nämlich zum philosophischen Text als solchem eine vergleichsweise naive Philosophiegeschichte nicht nur als historische, sondern auch als philoso Einstellung. Sie vertrauen auf die Fähigkeit von Texten, Erkenntnisse phische Disziplin zu pflegen. Denn nur dann bietet sich die Chance, nicht unterschiedlichster Art und Struktur sowohl darzustellen und zu verkör nur über philosophische Texte Erkenntnisse zu formulieren, sondern auch pern als auch dem Adressaten mitzuteilen. Ob ein Text diese Fähigkeit aus ihnen Wahrheit zu gewinnen. Es liegt auf der Hand, daß die Ergebnisse wirklich hat, wird gewöhnlich gar nicht mehr untersucht. Platon nimmt eines derartigen Umgangs mit Texten nicht immer in das Schema einfacher dagegen eine bewußte und reflektierte, vor allem aber eine distanzierende zweigliedriger Alternativen passen müssen. Man ist nämlich nicht darauf Haltung zu seinen Texten ein. Er erhebt nämlich gar nicht den Anspruch, beschränkt, den mit dem Text verbundenen Wahrheitsanspruch entweder unverschlüsselte Behauptungen zu formulieren, die einem anderen unmit zu bestätigen oder zu verwerfen. So wird sich in manchen Fällen herausstel telbar Einsicht in das verschaffen könnten, worauf sie sich beziehen. - Er len, daß sich ein solcher Anspruch nur dann einlösen läßt, wenn bestimmte bleibt skeptisch gegenüber dem Glauben, die textfähige Aussage könnte ein Zusatzbedingungen gegeben sind, von denen im Werk des interpretierten geeignetes Mittel sein, jenes Wissen zu verkörpern, um das es in der Autors nicht unbedingt explizit die Rede zu sein braucht. Im Blick auf diese Philosophie geht. Er re"hnet mit der Möglichkeit von Formen des Wissens, Möglichkeit empfiehlt es sich sogar geradezu, nach Zusatzbedingungen zu ,lie_sich nicht auf direkte Weise mitteilen und deswegen auch gar nicht suchen, unter denen sich die im behandelten Text vertretenen Thesen unmittelbar einem textfähigen Gebilde von der Art der Aussage zuordnen verifizieren lassen. lassen. Zwar weiß er, daß er trotz allem auf Texte nicht verzichten kann. Die Untersuchung eines philosophischen Textes führt nicht in jedem Fall Doch er behält stets die Grenzen im Auge, die jeder Aussage und jedem zu inhaltlich belangvollen Ergebnissen, wenn man den Wahrheitsanspruch Text auf Grund ihrer Natur gezogen sind. So macht erauf die Möglichkeit ernst nimmt und ihn, notfalls unter Einführung von Zusatzbedingungen, aufmerksam, daß die Sache, um die sich die Philosophie bemüht, vielleicht einzulösen sucht. Man wird sogar in der großen Mehrzahl der Fälle, in gar nicht von der Art ist, daß sie -als semantisches Korrelat textfähiger - denen man philosophische Texte der Vergangenheit in dieser Weise auszu Aussagen greifbar und mitteilbar wäre. Auch mit der Aufstellung einer werten unternimmt, scheitern. Doch von Bedeutung sind nun einmal noch so gut begründeten Lehre oder Theorie würde die Philosophie in gerade die nicht sehr zahlreichen Autoren, die einem, geht man mit ihren diesem Falle noch nicht an ihr Ziel kommen können. Texten in der angezeigten Weise um, fruchtbare und nichttriviale Einsich Das überlieferte Werk Platons ist ein sichtbarer Beweis dafür, daß das ten zu vermitteln vermögen. Es sind dies die Autoren, die man als klassische Bewußtsein von Problemen, wie sie mit philosophischen Texten als solchen Autoren auszuzeichnen gewöhnt ist. Daher ist es sinnvoll, Klassizität von verbunden sind, zur Gestaltung von Texten ganz besonderer und eigentüm philosophischen Texten geradezu durch ihre Fähigkeit zu definieren, Ein licher Art führen kann. Bei diesem Werk handelt es sich bekanntlich sichten in die von ihnen behandelte Sache zu vermitteln, wenn der mit zumeist um Dialoge, in denen ihr Autor selbst nicht auftritt. Platon macht ihnen verbundene Wahrheitsanspruch ernst genommen wird. Diese Ein sichten brauchen kein Bestandteil dessen zu sein, was man als Lehrmeinung des Autors zu bezeichnen pflegt. Die Lehrmeinung des Autors ist zwar ein "No interpretation of Plato's teaching can be proved fuHy by historical evidence. For the J wichtiger, aber eben nicht der alles beherrschende Gesichtspunkt, wenn es crucial part of his interpretation the interpreter has to fall back on his own resources: Plato does not relieve hirn oE the responsibility for discovering the decisive part of the argument by um die sachgerechte Behandlung klassischer philosophischer Texte geht. himself" (L. Strauss, Plato's political philosophy, in: Social Research 13, 1946, S. 326-367, Gerade die klassischen Texte können Antwort oft auch noch auf Fragen vgl. S. 351). 12 Einleitung sich niemals im eigenen Namen dem Leser gegenüber für die Richtigkeit bestimmter Behauptungen stark. Was mit seinen Texten mitgeteilt wird, ist daher nicht nur inhaltlich von dem verschieden, was in den Werken anderer philosophischer Autoren mitgeteilt wird. Denn Platons Texte unterscheiden sich bereits auf Grund ihrer Form von den Lehrtexten, die in der Philoso Erstes Kapitel: Das geschriebene Werk phie üblicherweise als Medium der Mitteilung fungieren. Es kann vorerst dahingestellt bleiben, Q,,_dieDialogform auch die Aufgabe hat, philosophi sche Lehren einzukleiden, die sich möglicherweise auch unabhängig von dieser Einkleidung formulieren und mitteilen ließen. Entsprechende Hypo § 1: Platons Schriftkritik thesen können und müssen an den Texten erprobt werden. Auf jeden Fall bleibt die Tatsache bestehen, daß das platonische Werk auf unmittelbare In Platons überliefertem Werk finden sich einige Stellen, an denen die und unverschlüsselte Weise jedenfalls keine philosophischen Lehren seines Frage nach der Struktur und nach der Leistung schriftlich fixierter Rede Autors präsentiert oder mitteilt. erörtert wird. Es sind Erörterungen, in denen es vornehmlich darum geht, Jede Platondeutung tut daher gut daran, auch die Probleme ernst zu die dem geschriebenen Wort durch seine eigene Natur gezogenen Grenzen nehmen, die durch<iie eigentümliche Form der platonischen Schriften sichtbar zu machen. Sie orientieren sich an Erwartungen, die man auf der aufgegeben sind. Hier wird deutlich, daß es eine nichttriviale Frage ist, ob Grundlage einer unreflektierten Einstellung der Schrift gegenüber oftmals sich die Bemühungen Platons darin erschöpfen, Lehren aufzustellen, Zll hegt; sie wollen zugleich erklären, warum solche Erwartungen notwendi begründen und in verschlüsselter Form mitzuteilen. Jede Lehre hat zu ihrer gerweise enttäuscht werden. Damit ist aber auch die Frage gestellt, ob es Grundlage Behauptungen darüber, daß ein bestimmter Sachverhalt besteht andere Instanzen gibt, die das zu leisten vermögen, was die schriftlich oder nicht besteht. Platons Werk stellt indessen schon durch seine Form in fixierte Rede manchmal leisten soll, aber eben doch nicht leisten kann. Ob Frage, ob jedes Wissen die Form einer Behauptung über etwas, was der Fall sich der Inhalt einer Erkenntnis oder eines Wissens überhaupt in einem ist, aufweist. Daher läuft man Gefahr, wesentliche Seiten von Platons Schriftwerk dokumentieren und darstellen läßt, ob er auf dem Wege über Philosophieren zu verfehlen, wenn man sich auf den Versuch beschränkt, eine derartige Dokumentation einem anderen mitgeteilt werden kann, - auf der Grundlage der überlieferten Texte Platons etwas zu rekonstruieren, derartige Fragen sind es, die in Platons Schriftkritik erörtert und schließlich was man dann als Platons systematische Lehre ansieh!. Dann wird man negativ beantwortet werden. nämlich jenen Gestalten des Wissens nicht mehr gerecht, die gar nicht das Bei jedem Versuch, Platons Philosophieren zu verstehen, kommt diesen Bestehen oder Nichtbestehen von Sachverhalten thematisch intendieren. Es Stellen und ihrer Deutung eine Schlüsselfunktion zu. Das ist noch niemals besteht Grund zu der Annahme, daß auch die Form von Platons überliefer ernsthaft bezweifelt worden. Denn unsere Kenntnis von der Philosophie tem Werk mit der Anerkennung derartiger Gestalten des Wissens im Platons stützt sich nun einmal auf die unter seinem Namen überlieferten Zusammenhang steht. Ihnen wird jedenfalls in der vorliegenden Untersu und in Gestalt von Texten vorliegenden Werke. Von der Bewertung der chung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Schriftkritik hängt daher auch ab, wie Platons überliefertes Werk im ganzen zu deuten ist. Erweist sich die Schriftkritik als triftig, so muß man prüfen, ob sie sich nicht auch auf jenes Werk bezieht, in dem Platons Philosophie dokumentiert zu sein scheint. Daß in dem unter Platons Namen überlieferten literarischen Werk die philosophischen Lehren ihres Autors niedergelegt sind, kann man dann nicht mehr als selbstverständlich voraussetzen. Gewiß ist uns auch die Schriftkritik selbst nur in schriftlicher Form, nämlich innerhalb dieses Werks überliefert. Doch auf der Grundlage von Überlegungen, die sich an die Feststellung dieser Tatsache anschließen lassen, kann man die Schriftkritik schwerlich entwerten. Das wäre allen falls dann möglich, wenn Platons Schriftkritik darauf zielte, ein Theorem zu begründen, das mit strenger Allgemeingültigkeit die Insuffizienz jeder schriftlichen Mitteilung im Bereich der Darstellung und Mitteilung von Wissen behauptete. Doch dieser Fall ist in Wirklichkeit nicht gegeben. 14 Das geschriebene Werk § 1: Platons Schriftkritik 15 Denn in Platons Schriftkritik geht es gar nicht so sehr darum, Theoreme einer kunstgerechten Rede zu beachtenden Regeln zum Thema hat. Gegen aufzustellen und zu begründen. Es geht vielmehr darum, eine Anleitung Ende des Dialogs geht es um die auch bereits in der zeitgenössischen zum angemessenen Umgang mit schriftlichen Dokumenten zu geben, der Rhetorik erörterte Frage, unter welchen Bedingungen es einer Rede ange der oft verkannten Eigenart des Schriftlichen gerecht zu werden vermag. messen sei, schriftlich fixiert zu werden'. Die Schriftkritik selbst wird in Deshalb läßt sich die Schriftkritik auf eine Weise deuten, bei der sich keine dem zwischen Sokrates und Phaidros geführten Dialog durch einen von logischen Schwierigkeiten aus der Tatsache ergeben, daß auch sie selbst in Sokrates erzählten Mythos von der Erfindung der Schrift eingeleitet. An ihn schriftlicher Gestalt überliefert ist. Platons Kritik sieht ohnehin die Schrift schließt sich eine Sacherörterung an. Mythos und Sacherörterung sind dort, wo es darum geht, Wissen und Einsicht zu vermitteln, nicht als verzahnt: Das von Sokrates mit seinem Partner Phaidros geführte Gespräch gänzlich wertlos an. Sie macht indessen auf die niemals ohne Rest zu schließt sich zwanglos an ein Gespräch zwischen den im erzählten Mythos beseitigende Unvollständigkeit und Vorläufigkeit alles Schriftlichen sowie auftretenden Personen an. auf die Voraussetzungen aufmerksam, unter denen jeder Text als Text Schon mit der Wahl der literarischen Form des Dialogs distanziert sich steht, gleichgültig, wovon er handelt. Sie hat ihr Ziel erreicht, wenn sie in Platon zumindest partiell von der Schriftlichkeit und ihren Beschränkun dem, der sie versteht, die Fähigkeit erweckt hat, der Eigenart des Schriftli gen. Der Beginn der Schriftkritik im "Phaidros" nimmt als erzählte chen im Umgang mit Texten gerecht zu werden. Hat man sachgerechtes Geschichte aber auch dem dialogischen Kontext gegenüber noch einmal Umgehen mit Texten erst einmal gelernt und eingeübt, so kann man es eine eigentümliche Distanz ein. Die Schriftkritik wird hier also mit den selbst dort bewähren, wo man es mit Texten zu tun hat, die von der Techniken einer in zweifacher Hinsicht indirekten Mitteilung eingeleitet. Leistungsfähigkeit des Schriftlichen und ihren Grenzen handeln. Der Intention des Lesers ist damit die Richtung gewiesen: Er wird nicht Wer Platons Schriftkritik verstanden hat, wird sehr skeptisch gegenüber unmittelbar mit einem an ihn adressierten Lehrtext konfrontiert, sondern jeder Einstellung sein, die Erkenntnis aus Schriftwerken gewinnen zu er wird Zuhörer eines auf der Ebene der literarischen Fiktion mündlich können glaubt. Dann stellt sich freilich die Frage, wie man mit einem geführten Dialogs, an dem er selbst nicht teilnimmt. Im Rahmen dieses philosophischen Text auf angemessene Weise umgehen sollte. Diese Frage Dialogs wird jedoch nicht gelehrt, sondern gefragt und geantwortet, erzählt stellt sich im Hinblick auf die literarische Eigenart von Platons Dialogen und erörtert. sogar mit besonderer Dringlichkeit. Angesichts dieser Werke geht es nicht Sokrates beruft sich auf von ihm angeblich Gehörtes, wenn er mit der nur darum, wie in ihnen Erkenntnisse ihres Autors dokumentiert sind. I Erzählung des Mythos von der Erfindung der Schrift beginnt (274c). Das ist Denn in diesem Falle müßte bereits ausgemacht sein, daß die Dialoge I nichts Ungewöhnliches, wo auch immer er einen Mythos als Medium oder jedenfalls den Zweck verfolgen, Lehrmeinungen ihres Autors darzustellen als Stimulans der Erörterung benutzt. Gleichwohl handelt es sich bei ! und mitzuteilen. Man ist heute leicht anzunehmen geneigt, nur sprachliche i diesem Mythos um eine Erfindung des Sokrates, wenigstens was die I Formulierungen könnten eine sichere Basis für philosophische Analyse und Ausgestaltung seines Inhalts angeht. Sein Partner Phaidros bemerkt dies Diskussion abgeben, zumal dann, wenn man davon ausgeht, die Aufgabe auch sogleich (275b). Sokrates will sich für die Wahrheit des Mythos auch des philosophischen Denkens erschöpfe sich darin, Sätze über Sachverhalte gar nicht verbürgen; ob er wahr ist, wissen nach seiner Meinung nur I von ganz bestimmter Art zu finden, zu begründen und zu dokumentieren. diejenigen, die ihn überliefert haben (274c). Sokrates nimmt hier gegenüber Hierbei macht es dann keinen Unterschied, ob man sich an Texte aus der I der Wahrheits frage eine bei ihm ungewohnte Reserve ein; das hindert ihn Geschichte der Philosophie oder aber an Formulierungen auf der Basis I aber nicbt daran, seinen Partner zu ermahnen, sich mehr um die Wahrheit einer Kunstsprache hält. Niemand wird den Gewinn aus der Hand geben als um die Herkunft einer Rede zu kümmern (275b). - Mit der Reserve, die I wollen, den man aus einer Arbeit ziehen kann, die von dieser Annahme Sokrates der Wahrheitsfrage gegenüber einnimmt, wird signalisiert, daß • ausgeht. Platons Schriftkritik kann einen indessen auf Formen und I auch die mündliche Rede nicht den Anspruch einlösen kann, Wahrheit Momente des Wissens aufmerksam machen, die nicht ohne Rest in einem '1 darzustellen oder einem anderen zu vermitteln, wenn die Augenzeugen, die ,0 Lehrtext mitgeteilt werden können, - auch nicht in einem platonischen allein imstande wären, diesen Wahrheitsanspruch zu sichern, nicht anwe Dialog. Es sind Formen und Momente, die bei keinem Versuch einer send sind und daher auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Deutung von Platons Werk vernachlässigt werden sollten. Die Frage nach der Bedeutung der Schriftlichkeit kann implizit auch dort präsent sein, wo 1 sie nicht thematisiert wird. So läßt Platon zu Beginn des Dialogs Phaidros den Text einer Rede In einer häufig zitierten und behandelten Passage aus dem Schlußteil des aus der Feder des (am Dialog nicht teilnehmenden) Rhetors Lysias mitbringen (Phdr. 227c). Es "Phaidros" (274b-278b) wird eine Kritik an der Schriftlichkeit im Rahmen ist bei P!aton eine Seltenheit) wenn in einem Dialog einmal-wie hier - ein Text vorgelesen einer Erörterung vorgetragen, die die bei der Anfertigung und beim Vortrag wird (230cff.; vgl. 262c, 263e). T I 16 Das geschriebene Werk § 1: Platons Schriftkritik 17 Der erzählte Mythos, obwohl in der literarischen Fiktion mündlich mitge Sokrates auch angedeutet: Als Erzähler erklärt er, es bedürfe einer langen teilt, weist insofern also gerade Merkmale auf, wie sie für Texte charakteri Rede, wollte man alles das durchgehen, was Thamos dem Theuth über jede stisch sind. Denn Texte sind unfähig, selbst Rechenschaft über ihren Inhalt der von ihm erfundenen Künste gesagt habe (274e). Andeutungen dieses zu geben. Nicht zufällig läßt Sokrates den von ihm erzählten Mythos in Typs finden sich bei Platon nicht selten. Wollte man auf sie eingehen, einem fremden Umkreis, nämlich in Ägypten spielen. müßte man im vorliegenden Fall die von Thamos vorgetragenen Beurtei Der Inhalt des Mythos bietet dem Verständnis kaum Schwierigkeiten. Er lungen zu rekonstruieren versuchen. Eine derartige Rekonstruktion würde erzählt von Theuth, einem älteren ägyptischen Lokalgott, der nicht nur beispielsweise auch Elemente einer Theorie der Mathematik enthalten. Der Zahl und Rechnung, Geometrie und Astronomie, Würfel- und Brettspiel, Mythos, der die Schrift, die Mathematik und bestimmte Spiele auf ein und sondern auch die Buchstabenschrift erfunden hat'. Theuth präsentiert seine denselben Erfinder zurückführt, gibt damit einen Hinweis, dessen Intention Erfindungen dem ihm übergeordneten und über ganz Ägypten herrschen man nicht übersehen sollte. den Gottkönig Thamos, weil er alle Ägypter an ihrem Nutzen teilhaben Schon innerhalb des Mythos wird der Gebrauch einer Sache mit ihrer lassen möchte. Thamos führt daraufhin mit Theuth ein Gespräch, das die Herstellung konfrontiert. Hier haben wir es mit einem Denkschema zu tun, Frage nach dem Nutzen' einer jeden Erfindung in den Mittelpunkt stellt. das zu den wichtigsten Orientierungshilfen des platonischen Denkens Der König beurteilt jede. Erfindung alternativ': Was Theuth über den gehört. Das Urteil dessen, der eine Sache zu gebrauchen weiß, hat nämlich Nutzen einer jeden Erfindung vorträgt, wird von Thamos teils gelobt, teils stets einen höheren Rang als das Urteil dessen, der sie herstellt. Denn was getadelt. Die Beurteilung der Schrift führt zu einem Dissens. Theuth preist die Schrift eigentlich ist, zeigt sich nur dann, wenn man sie in ihrem sie als ein Mittel, Wissen und Gedächtnis bei den Ägyptern zu fördern. Gebrauch betrachtet und wenn man den Nutzen und den Schaden Thamos widerspricht: Es seien zwei ganz verschiedene Dinge, ob man eine abschätzt, den dieser Gebrauch zur Folge hat. Zwar wird auch der Herstel Kunst erfinde oder ob man abschätze, welchen Nutzen und welchen ler einer Sache Meinungen über ihren Nutzen entwickeln. Doch diese Schaden sie denen bringen kann, die von ihr Gebrauch machen. Diese am Meinungen bedürfen der Korrektur. Im Mythos muß sich denn auch Gebrauch einer Sache, an ihrem Nutzen und Schaden orientierte Beurtei Theuth als Erfinder der Schrift gegenüber Thamos als dem Inhaber des lungskompetenz nimmt Thamos für sich gegenüber Theuth in Anspruch. zugehörigen Gebrauchswissens mit einer untergeordneten Rolle begnügen. Nach seinem Urteil fördert die Schrift die Vergeßlichkeit. Denn sie verführe Theuth zeigt im Mythos noch eine naive Einstellung zu seinen Erfindungen. dazu, das Gedächtnis zu vernachlässigen. Wer sich auf die Schrift verlasse, Er ist sich der Ambivalenz eines jeden Dinges noch nicht bewußt geworden. erinnere sich nicht mehr von selbst; er habe sich von äußeren Dingen Es hängt nämlich von den teleologischen und den pragmatischen Zusam abhängig gemacht, wenn er sich von ihnen erinnern lasse. Nicht für das menhängen ab, in die man ein Ding einfügt, ob es sich als nützlich oder als Gedächtnis der sich aus eigener Kraft erinnernden Seele sei die Schrift ein schädlich erweist. Was ein Ding eigentlich ist, weiß jedenfalls der nicht, der Hilfsmittel, sondern nur für die äußerer Anstöße bedürftige Erinnerung'. es nicht in solche Zusammenhänge einzuordnen und aus ihnen zu beurtei Auch für das Wissen' ist die Schrift nach dem Urteil des Thamos nicht von len versteht. Im Mythos verkörpert Thamos die Kompetenz zu jener Nutzen. Sie vermittele dem Schüler kein wahres Wissen, sondern höchstens Beurteilung, die über die Betrachtung des Dinges in seiner puren Gegen Dünkelwissen. Mit Hilfe der Schrift ziehe man Menschen heran, die sich ständlichkeit hinausgeht, weil sie sich an jener Ambivalenz orientiert, die den Anschein von Wissenden geben, in Wirklichkeit aber doch zumeist sich an einem Ding erst dann zeigt, wenn man es in unterschiedliche nichts wissen. Gebrauchsrelationen einfügt. Damit endet der Mythos. Das nun folgende Gespräch zwischen Sokrates Schon diese Umstände weisen darauf hin, daß die Kritik des "Phaidros" und Phaidros setzt in der Sache den im Mythos zwischen Theuth und keineswegs eine pauschale Entwertung alles Schriftlichen bezweckt. Die Thamos geführten Dialog fort. Ohnehin wird im Mythos nicht alles das Kritik will vielmehr die Einsicht vermitteln, daß man der Schrift dann nicht gesagt, was innerhalb seines Rahmens gesagt werden könnte. Das wird von gerecht wird, wenn· man sie nicht im Blick auf die pragmatischen Relatio nen beurteilt, in die sie sich einfügen läßt. Kritisiert wird nicht die Schrift als solche. Kritisiert wird, wer mit ihr auf unangemessene Weise umgeht 2 Zur Parallelbehandlung von (Brett-)Spiel und mathematischer Wissenschaft vgl. Charm. und wer ihr Leistungen abverlangt, die sie nun einmal nicht erbringen 174b, G~)fg. 450 d, insbesondere Nom. 820d. Zu Theuth als Erfinder der "Grammatik" vgl. auch Phtl. 18b. kann. Wer Aufgeschriebenes besitzt oder kennt, unterliegt leicht dem , wrpE).{a, Phdr. 274d. Irrglauben, damit auch bereits das zu wissen und zu verstehen, wovon es ,4 hr' aJ1.-Cf6T6(Ja, Phdr. 274e. handelt. Einer unreflektierten Einstellung bleibt zumeist verborgen, daß ~vri~ry ,j,,6~'V1/a,<;, Phdr. 275 •. Texte selbst im günstigsten Fall nur die Funktion eines Werkzeugs erfüllen, , aorpia, Phdr. 274el. 2 Wieland, !)!aton 18 Das geschriebene Werk § 1: Platons Schriftkritik 19 wenn es darum geht, wirkliches Wissen zu erwerben. Hier bedarf es stets Der Kern von Platons Schriftkritik besteht also nicht in einer äußerlichen einer Instanz, die dieses Werkzeug kompetent zu gebrauchen weiß. Nur Konfrontation graphischer und akustischer Medien der Mitteilung. Denn über Scheinwissen verfügt, wer lediglich den Besitz eines solchen Werk es geht in dieser Kritik darum, jenes Beziehungsgefüge vor Augen zu stellen, zeugs demonstriert, ohne auf rechte Weise mit ihm umgehen zu können. innerhalb dessen jede Rede, sei sie nun mündlich oder schriftlich geäußert, Darauf beruht die Möglichkeit, den Besitz von Wissen vorzutäuschen. HIer nur ein unselbständiges Moment darstellt. Dieses Beziehungsgefüge zwi macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob man nur andere täuscht oder schen Sprecher und Adressat gewinnt freilich im Falle der geschriebenen außerdem auch noch sich selbst. Rede eine besonders deutliche Kontur. Denn gerade die geschriebene Rede Der Mythos selbst deutet nur an, was die Schrift jedenfalls nicht zu zeigt oftmals - wenngleich nicht immer - eine Art von Ausfallphänomen leisten vermag. Die an ihn sich anschließende Erörterung bestimmt die an. Gerade weil sie sich kraft ihrer gegenständlichen Fixierung aus jenem Leistungsfähigkeit der Schrift auch in positiver Weise. Gemäß einer von Gefüge leicht herauslösen läßt, vermag sie seine Struktur gleichsam in der Sokrates vorgetragenen Überlegung kann ein Text an das erinnern, wovon Art einer Negativkopie sichtbar zu machen. Wenn Sokrates die geschrie das Geschriebene handelt. Das ist aber nur dort möglich, wo er auf einen bene Rede beurteilt, so bleibt er daher stets an ihrem Urbild, nämlich an bereits Wissenden trifft, der nur einer Erinnerungshilfe bedarf'. Die Schrift jener Rede orientiert, die mit Einsicht in die Seele des Lernenden "geschrie kann als solche derartiges Wissen weder hervorbringen noch mitteilen; sie ben" istU Anders als ihr - im eigentlichen Sinne des Wortes verstandenes • kann höchstens Wissen reaktivieren, das bereits latent vorhanden ist. Dann geschriebenes Abbild ist sie fähig, sich zu verteidigen. Auch weiß sie, wem fungiert sie als bloßer Anlaß für die Erinnerung an etwas, was selbst in die gegenüber sie zu reden und wem gegenüber sie zu schweigen hat12 Man • schriftliche Fixierung gar nicht eingeht. Das Wissen ist also im schriftlichen wird also der geschriebenen Rede nur gerecht, wenn man sie zu diesem Dokument nicht verkörpert. Einfältig wäre es, wie Sokrates betont, wollte ihrem Vorbild in Beziehung setzt und wenn man weiß, daß sie dieses man eine Kunstfertigkeit" mit dem Mittel der Schrift zu tradieren suchen. Vorbild immer nur auf sehr unvollständige Weise darstellen kann. So bleibt Gerade hier handelt es sich um eine Wissensform, bei der es auf der Hand die geschriebene Rede im Vergleich zu jener eigentlichen und ernsthaften liegt, daß sie sich der vollständigen schriftlichen Objektivierung entzieht. Rede ein bloßes Spiel". Wer über wirkliches Wissen verfügt, wird daher Sokrates macht auf weitere Eigenschaften der geschriebenen Rede auf allenfalls zum Spiel oder zum Zweck der Erinnerungshilfe versuchen, den merksam: Sie hat sich im Gegensatz zur gesprochenen Rede gegenüber Inhalt dieses Wissens in einem Text darzustellen. Gerade ihm ist klar, daß ihrem Urheber verselbständigt. So findet man sie auch an Orten, an denen das, was das Wissen erst zum Wissen macht, im Text gar nicht greifbar ihr Urheber nicht anwesend ist. Das scheint zunächst ein Vorzug zu sein, in wird. Zum Wissen gehört nämlich stets die als solche gar nicht aufschreib Wirklichkeit handelt es sich aber um einen Mangel. Denn die Rede vermag bare Fähigkeit, angesichts möglicher Adressaten mit ihm umzugehen und als solche nichts; nur eine hinter ihr stehende Instanz vermag etwas, wenn Rechenschaft von ihm zu geben. Sie kommt nur dem Wissenden zu, sie sich ihrer als eines Mittels bedient. Auf Fragen antworten kann nicht der dagegen niemals einem Text. Wo es dem Wissenden ernst ist, verläßt er sich Text, sondern nur sein Urheber. Kein Text kann sich selbst explizieren; er daher nicht auf die Schrift. Er wird sich, wie es Sokrates ausdrückt, signalisiert immer nur ein und dasselbe'. Sokrates kann das Geschriebene unmittelbar an eine verwandte Seele wenden und dort mit Einsicht Reden daher auch mit dem gemalten Bild vergleichen (275d): Ein Bild kann die pflanzen und säen, die im Gegensatz zu Texten lebendig sind. Diese Reden dargestellte Person nicht leibhaftig präsentieren; es kann allenfalls den werden nicht steril sein, sondern sie werden Früchte tragen, und sie werden Schein der Lebendigkeit vorspiegeln. Weder das Bild des Malers noch der sich selbst ebenso wie dem, der sie gepflanzt hat, zu Hilfe kommen können Text können auf Fragen antworten. Spricht man sie an, so schweigen sie. (vgl. 276ef.). Das geschriebene Wort kann auch nicht aus eigener Kraft den richtigen Die Phaidrosstelle enthält keine vollständige Texttheorie. Sie macht Adressaten finden. Es kann sich nicht verteidigen und bleibt daher jedem jedoch auf den komll1Unikativen Realkontext aufmerksam, in den eine jede Mißverständnis schutzlos ausgeliefert. Stets bedarf es der Hilfe seines Rede, mag sie geschrieben oder gesprochen sein, von Hause aus gehört. Urhebers (275e). Nur er weiß, für wen seine Rede bestimmt ist und für wen Was mit Hilfe einer Rede ausgedrückt und bewirkt werden soll, läßt sich nichtlO, niemals ausschließlich ihrem Wortlaut entnehmen. Man muß vielmehr stets 7 Phdr. 275d: ... '/:"011 Elb6w vnoj.Lvfjam 1CS(JL cbv äv dL a yeY(Juppeva, vgl. 278a. den Realkontext in Rechnung stellen, innerhalb dessen der Wortlaut der , dXV1/, Phdr. 275c. 9 Phdr. 275d; vgl. Prot. 329a: Bücher können weder fragen noch antworten. Sie gleichen 11 f..lH' br:wrr]p:rJ; y{}(XtpHat sv rfj roD ,.wvf}avovro; 'ljJvxiJ, Phdr. 276a, vgl. 278a. Kesseln, die lange nachtönen, wenn sie einmal angeschlagen worden sind. . 12 OVVa7:oq J.tEV &J.Lvvm eavrtp, eman]/lwv 6f; AEyEW Te :J<,ui myäv Jr(JOf aUf bä, Phdr. 10 Von hier aus ist die Redeweise zu verstehen, gemäß der jemand einem Logos zu HIlfe 276a. kommt, z.B. Phd. 88e; Theait. 164a, 13 Jrwbtd, Phdr. 276bf., 277e. 20 Das geschriebene Werk § 1: Platons Schriftkritik 21 Rede immer nur den Status eines unselbständigen funktionellen Elementes ren, sich mit den Mitteln der Sprache auszudrücken und damit bei seinem hat. Zu diesem Realkontext gehört ein bestimmter Urheber mitsamt seinen Partner etwas Bestimmtes zu bewirken - beispielsweise den Gewinn von Fähigkeiten und dem in seiner Seele liegenden Wissen, ein bestimmter Einsicht. Doch der Wissende ist diesen Mitteln nicht ausgeliefert, sondern Adressat sowie die Randbedingungen der konkreten Sprechsituation. Der er verfügt über sie. Sein Wissen wird nicht als solches unmittelbar im Wortlaut der Rede selbst hat innerhalb dieses Realkontextes insttumenta Wortlaut der sprachlichen Ausdrücke greifbar oder vorstellig. Es bewährt len Charakter. Nicht die Rede selbst sagt etwas, sondern mit ihrer Hilfe sich dagegen in der Fähigkeit des Wissenden, mit solchen Ausdrücken im wird von jemandem etwas zu jemandem gesagt. Sie erfüllt ihre Funktion Blick auf die Sache, auf den Adressaten und auf die Situation richtig um so besser, je mehr es dem Sprecher gelingt, die Aufmerksamkeit des umzugehen. Das geschriebene Wort ist indessen dem Realkontext entho Adressaten mit ihrer Hilfe nicht auf ihren Wortlaut, sondern auf die ben. Es erweckt den Anschein, als wäre es ihm gegenüber invariant; es kann intendierte Sache zu richten. Gerade wenn sie diese ihre Funktion erfüllt, so auftreten und so rezipiert werden, als wäre es nicht bloß Werkzeug oder wird sie als solche nicht thematisiert. Dann besteht auch nicht die Gefahr Indikator eines hinter ihm stehenden Wissens, sondern als würde es dieses des Irrglaubens, die gegenständliche Kenntnis einer Formulierung könnte Wissen selbst gegenständlich verkörpern und mitteilbar machen. Wissen bereits das Verständnis dessen garantieren, was der Sprecher mit ihrer Hilfe läßt sich indessen nicht in der Weise mitteilen, in der Dinge übergeben oder ausdrücken und mitteilen wollte. ausgetauscht werden können. Was wie eine Mitteilung von Wissensinhal Wer gesprochene Rede versteht, hat das Beziehungsgefüge dieses Real ten aussehen mag, ist in Wirklichkeit immer nur ein Versuch, jemandem die kontextes immer schon in Rechnung gestellt, mag ihm dies nun bewußt sein Möglichkeit zu geben, das fragliche Wissen selbst zu erwerben oder ihm oder nicht. Sicher kann auch hier einmal die gemeinte Sache durch den wenigstens dabei zu helfen. Der Erfolg dieser Bemühung kann niemals Wortlaut des Gesprochenen verdeckt werden. Doch der Sprecher bleibt garantiert werden. Nicht zufällig bedient sich Sokrates hier einer Metapho stets präsent und er hat immer die Chance, Herr der Situation zu bleiben rik, die dem Bereich des Säens, Pflanzens und Wachsens entstammt (vgl. und jedes Mißverständnis auf der Seite seines Partners zu korrigieren, 276e). sobald er es bemerkt. Der Angesprochene hat umgekehrt stets die Möglich Die Wirkung des geschriebenen Wortes kann von seinem Urheber nicht keit der Rückfrage. Diese Möglichkeit bietet sich dagegen nicht mehr, wenn in gleicher Weise wie die des gesprochenen Wortes kontrolliert werden. man es mit einem Text zu tun hat. Hier ist der instrumentale Charakter der Gewiß ist es möglich, hermeneutische Techniken zu entwickeln, die es Rede nicht mehr offenkundig. Denn die schriftliche Fixierung verleiht der einem erlauben, die Gegenständlichkeit und den Wortlaut eines Textes zu Rede den Schein der Selbständigkeit und der Endgültigkeit. Es sieht aus, als relativieren und ihn auf etwas hin zu verstehen, was nicht mehr in ihm wäre sie der Beziehung zwischen Sprecher und Adressat enthoben. Der explizit ausgedrückt ist. Doch wenn man solcher Techniken bedarf, so nur gesprochenen Rede eignet dagegen der Charakter der Vorläufigkeit. Es deswegen, weil das geschriebene Wort zunächst wirklich oft so angesehen wäre ein der Sache wie der Sprache gegenüber inadäquates Verhalten, wird, als könnte in ihm Wissen unmittelbar präsent sein (vgl. 275d). Der wollte man sich selbst oder seinen Gesprächspartner auf den Wortlaut einer Wissende kann sein Wissen jedoch niemals ganz zum Gegenstand machen; bestimmten gegenständlich fixierbaren Formulierung festlegen. Ein Spre es geht in keiner sprachlichen Formulierung ohne Rest auf. Es gibt keine cher, der weiß, wovon er redet, ist niemals fest an einen bestimmten, Formulierung, die sich nicht mehr angreifen ließe; ebensowenig gibt es eine kontingenten Wortlaut gebunden. Er kann das, was er intendiert, immer Formulierung, die nicht der Explikation und der Verteidigung fähig und auch noch mit Hilfe anderer Formulierungen ausdrücken. Der Wortlaut bedürftig wäre. Erst die Kompetenz zur Explikation und Zur Verteidigung des Gesagten hat für ihn ebenso wie für den sich 'situationsgerecht verhal aber zeigt das Vorliegen wirklichen Wissens an. Der Wissende bedient sich tenden Partner nur instrumentalen Charakter. Mit seiner Hilfe kann jeman nur der sprachlichen Formulierungen, und er kann mit ihrer Hilfe etwas dem etwas mitgeteilt oder erschlossen werden. Um innerhalb eines Real aussagen und zu verstehen geben. Das können die sprachlichen Formulie kontextes jemandem etwas erschließen zu können, braucht aber die Rede rungen selbst nicht; sie können nur noch signalisieren14 zumal dann, wenn , im Hinblick auf die gemeinte Sache durchaus keine Abbildfunktion zu sie schriftlich fixiert sind. Die Kompetenz des Wissenden zeigt sich daher erfüllen. Sie ist allenfalls ein Indikator, aber kein Abbild möglichen Wis auch in seiner Fähigkeit, den möglichen Adressaten der jeweiligen Rede sens. Das gilt selbst dann, wenn man von "Abbildung" lediglich in der richtig zu beurteilen. Er weiß also nicht nur, wie er sich der sprachlichen logischen Bedeutung des Wortes spricht. Mittel zu bedienen hat, sondern er weiß auch, wem gegenüber er welche Den dem Wissen zukommenden Ort findet man, folgt man den Andeu Mittel auf gezielte Weise einsetzen muß. Es ist eine Kompetenz, die sich auf tungen im "Phaidros", in keinem sprachlichen Gebilde, wohl aber in der Seele. Zwar kann sich das Wissen in der Fähigkeit seines Inhabers bewäh- 14 Vgl. den Gegensatz von AEye~v und 07/11atVe~V, Phdr. 275d.
