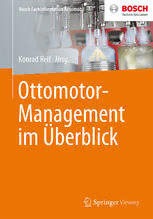
Ottomotor-Management im Überblick PDF
Preview Ottomotor-Management im Überblick
Bosch Fachinformation Automobil Konrad Reif Hrsg. Ottomotor- Management im Überblick Bosch Fachinformation Automobil BOSCH Fachinformation Automobil enthält das Basis- wissen des weltweit größten Automobilzulieferers aus erster Hand. Anwendungsbezogene Darstellungen sind das Kenn- zeichen dieser Buchreihe. Ganz auf den Bedarf an praxis- nahem Hintergrundwissen zugeschnitten, findet der Auto- Fachmann ausführliche Angaben, die zum Verständnis moderner Fahrzeuge benötigt werden. Sie eignet sich damit hervorragend für den Alltag des Entwicklungsingenieurs, für die berufliche Weiterbildung, für Lehrgänge, zum Selbststudium oder zum Nachschlagen in der Werkstatt. Alle Informationen sind so gestaltet, dass sich auch ein Leser zurechtfindet, für den das Thema neu ist. Die bedarfs- gerechte Angebotspalette beginnt beim Kraftfahrtechnischen Taschenbuch, das als handliches Nachschlagewerk den kompakten Einblick in die aktuelle Fahrzeugtechnik bietet. Einen umfassenden Einblick in größere, zusammen- hängende Themengebiete bieten die ausführlichen Fach- bücher im gebundenen Hardcover-Umschlag. Anschauliche Detailinformationen mit deutlich reduziertem Umfang werden, im flexiblen Einband, zu konkreten Aufgaben- stellungen erklärt. Kleinere Lernhefte zu thematisch abge- grenzten Wissensgebieten stehen in den Lernordnern „Auto- mobilelektronik lernen“ und „Motorsteuerung lernen“ bereit. Konrad Reif Herausgeber Ottomotor-Management im Überblick Herausgeber Prof.Dr.-Ing.KonradReif DualeHochschuleBaden-Württemberg Ravensburg,CampusFriedrichshafen Friedrichshafen,Deutschland (cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:73)(cid:35)(cid:71)(cid:75)(cid:69)(cid:90)(cid:16)(cid:85)(cid:68)(cid:89)(cid:72)(cid:81)(cid:86)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:74)(cid:17)(cid:71)(cid:72)(cid:3) ISBN978-3-658-09523-9 ISBN978-3-658-09524-6(eBook) DOI10.1007/978-3-658-09524-6 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertebibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.d-nb.deabrufbar. SpringerVieweg ©SpringerFachmedienWiesbaden2015 DasWerkeinschließlichallerseinerTeileisturheberrechtlichgeschützt.JedeVerwertung,dienichtaus- drücklichvomUrheberrechtsgesetzzugelassenist,bedarfdervorherigenZustimmungdesVerlags.Das giltinsbesonderefürVervielfältigungen,Bearbeitungen,Übersetzungen,MikroverfilmungenunddieEin- speicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen. DieWiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. indiesem Werk be- rechtigtauch ohnebesondere Kennzeichnung nicht zuder Annahme, dasssolcheNamenimSinneder Warenzeichen- undMarkenschutz-Gesetzgebung alsfreizubetrachtenwärenunddahervonjedermann benutztwerdendürften. DerVerlag,dieAutorenunddieHerausgebergehendavonaus,dassdieAngabenundInformationenin diesemWerkzumZeitpunkt derVeröffentlichungvollständigundkorrektsind.Weder derVerlagnoch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit,Gewähr für den Inhalt des Werkes,etwaigeFehleroderÄußerungen. GedrucktaufsäurefreiemundchlorfreigebleichtemPapier. SpringerFachmedienWiesbadenistTeilderFachverlagsgruppeSpringerScience+BusinessMedia (www.springer.com) V Vorwort Die Technik im Kraftfahrzeug hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Der Einzelne, der beruflich mit dem Thema beschäftigt ist, muss immer mehr tun, um mit diesen Neuerungen Schritt zu halten. Mittlerweile spielen viele neue Themen der Wissenschaft und Technik in Kraftfahrzeugen eine große Rolle. Dies sind nicht nur neue Themen aus der klassi- schen Fahrzeug- und Motorentechnik, sondern auch aus der Elektronik und aus der Informa- tionstechnik. Diese Themen sind zwar für sich in unterschiedlichen Publikationen gedruckt oder im Internet dokumentiert, also prinzipiell für jeden verfügbar; jedoch ist für jemanden, der sich neu in ein Thema einarbeiten will, die Fülle der Literatur häufig weder überblickbar noch in der dafür verfügbaren Zeit lesbar. Aufgrund der verschiedenen beruflichen Tätigkei- ten in der Automobil- und Zulieferindustrie sind zudem unterschiedlich tiefe Ausführungen gefragt. Gerade heute ist es so wichtig wie früher: Wer die Entwicklung mit gestalten will, muss sich mit den grundlegenden wichtigen Themen gut auskennen. Hierbei sind nicht nur die Hoch- schulen mit den Studienangeboten und die Arbeitgeber mit Weiterbildungsmaßnahmen in der Pflicht. Der rasche Technologiewechsel zwingt zum lebenslangen Lernen, auch in Form des Selbststudiums. Hier setzt die Schriftenreihe „Bosch Fachinformation Automobil“ an. Sie bietet eine umfas- sende und einheitliche Darstellung wichtiger Themen aus der Kraftfahrzeugtechnik in kom- pakter, verständlicher und praxisrelevanter Form. Dies ist dadurch möglich, dass die Inhalte von Fachleuten verfasst wurden, die in den Entwicklungsabteilungen von Bosch an genau den dargestellten Themen arbeiten. Die Schriftenreihe ist so gestaltet, dass sich auch ein Leser zu- rechtfindet, für den das Thema neu ist. Die Kapitel sind in einer Zeit lesbar, die auch ein sehr beschäftigter Arbeitnehmer dafür aufbringen kann. ,,Ottomotor-Management im Überblick“ enthält einen Überblick über die Steuerung und Regelung von Ottomotoren. Es werden die Grundlagen des Ottomotors und die für die Steue- rung und Regelung zentralen Themen dargestellt. Dies sind zum einen die klassischen The- men Kraftstoffversorgung, Füllungssteuerung, Einspritzung, Zündung und Abgasnachbe- handlung. Zum anderen sind aber auch die typischen Elektronik-Themen wie Sensoren, elektronische Steuerung und Regelung, Steuergerät und Diagnose entsprechend behandelt. Das vorliegende Buch ist eine Auskopplung aus dem gebundenen Buch ,,Ottomotor- Management“ der Reihe Bosch Fachinformation Automobil und wurde neu zusammen- gestellt. Für weiterführende Informationen zu diesem Thema wird auf dieses Buch verwiesen. Friedrichshafen, im August 2015 Konrad Reif VI Inhaltsverzeichnis Grundlagen des Ottomotors λ-Sonden ........................................................................148 Arbeitsweise .......................................................................2 Zweipunkt-λ-Sonden ...................................................149 Zylinderfüllung ....................................................................7 Breitband-λ-Sonde .......................................................152 Verbrennung .....................................................................15 NOx-Sensor ...................................................................155 Drehmoment, Leistung und Verbrauch .......................19 Elektronische Steuerung und Regelung Kraftstoffversorgung Übersicht ........................................................................158 Überblick ...........................................................................24 Betriebsdatenverarbeitung ........................................160 Komponenten der Kraftstoffförderung ........................29 Systembeispiele ...........................................................163 Rückhaltesysteme für Kraftstoffdämpfe, Systemstruktur ..............................................................168 Tankentlüftung ..........................................................36 Softwarestruktur ............................................................179 Ottokraftstoffe ..................................................................38 Steuergeräteapplikation .............................................189 Füllungssteuerung Steuergerät Elektronische M otorleistungssteuerung .....................48 Einführung, Anforderungen und Dynamische Aufladung ..................................................51 Einsatzbedingungen ............................................198 Aufladung ..........................................................................54 Elektronischer Aufbau des Steuergerätes ..............198 Abgasrückführung ...........................................................64 Rechnerkern ..................................................................201 Sensorik .........................................................................204 Einspritzung Aktor-Ansteuerung .......................................................206 Applikation von Steuerg eräten in Saugrohreinspritzung .....................................................67 Fahrzeugprojekten ................................................207 Benzin-Direkteinspritzung .............................................83 Hardware-nahe Software ...........................................209 Mechanik ........................................................................211 Zündung Magnetzündung ............................................................104 Diagnose Batteriezündung ...........................................................104 Überwachung im Fahrbetrieb – Induktive Zündanlage ..................................................106 On-Board-Diagnose ............................................214 OBD-System für Pkw und leichte Nfz .....................216 Abgasnachbehandlung OBD-Funktionen ..........................................................220 Abgasemissionen und Schadstoffe .........................112 Diagnose in der Werkstatt .........................................233 Einflüsse auf Rohemissionen .....................................115 Katalytische Abgasreinigung .....................................120 Abkürzungsverzeichnis ...............................................238 Stichwortverzeichnis....................................................245 Sensoren Einsatz im Kraftfahrzeug .............................................132 Temperatursensoren ....................................................133 Motordrehzahlsensoren ..............................................135 Heißfilm-Luftmassenmesser ......................................140 Piezoelektrische Klopfsensoren ................................143 Mikromechanische D ruck sensoren ..........................144 Hochdrucksensoren ....................................................147 Herausgeber/Autoren Herausgeber Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif Autoren und Mitwirkende Dr.-Ing. David Lejsek, Dipl.-Ing. Uwe Müller, Dr.-Ing. Andreas Kufferath, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dr.-Ing. André Kulzer, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, (Einspritzung) Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dipl.-Ing. Klaus Winkler, (Grundlagen des Ottomotors) Dr.-Ing. Wilfried Müller, Umicore AG & Co. KG, Dipl.-Ing. Andreas Posselt, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dr.-Ing. Jens Wolber, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Ing.-grad. Peter Schelhas, (Abgasnachbehandlung) Dipl.-Ing. Manfred Franz, Dipl.-Ing. (FH) Horst Kirschner, Dr.-Ing. Manfred Strohrmann, Dipl.-Ing. Andreas Pape, Dr.-Ing. Berndt Cramer, Dr. rer. nat. Winfried Langer, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dipl.-Ing. Peter Kolb, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dr. rer. nat. Jörg Ullmann, (Sensoren) Günther Straub, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dipl.-Ing. Stefan Schneider, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dipl.-Ing. Andreas Blumenstock, (Kraftstoffversorgung) Dipl.-Ing. Oliver Pertler, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dr.-Ing. Martin Brandt, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dr.-Ing. Alex Grossmann, (Elektronische Steuerung und Regelung) Dipl.-Ing. Markus Deissler, Prof. Dr. Kurt Kirsten, IDK GmbH Dipl.-Ing. Hans-Walter Schmitt, Dipl.-Ing. Michael Bäuerle, Dipl.-Ing. Hans-Peter Ströbele, Dipl.-Ing. Martin Rauscher, Dipl.-Ing. Axel Aue, Dr.-Ing. Jochen Müller, Dipl.-Ing. Norbert Jeggle, Bosch Mahle Turbo Dipl.-Ing. Andreas Müller, Systems GmbH & Co. KG, Dipl.-Ing. Wolfgang Löwl, Dr.-Ing. Wolfgang Samenfink, Dipl.-Ing. Jochen Schneider, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dipl.-Ing. Jörg Gebers, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, (Füllungssteuerung) Duale Hochschule Baden-Württemberg. (Steuergerät) Dipl.-Ing. Andreas Posselt, Dipl.-Ing. Markus Gesk, Dr.-Ing. Markus Willimowski, Dipl.-Ing. Anja Melsheimer, Dipl.-Ing. Jens Leideck, Dipl.-Ing. (BA) Ferdinand Reiter, Prof. Dr.-Ing. Konrad Reif, Dipl.-Ing. (FH) Klaus Joos, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dipl.-Ing. Peter Schenk, (Diagnose) Dr.-Ing. Andreas Kufferath, Dr.-Ing. Wolfgang Samenfink, Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Dipl.-Ing. Andreas Glaser, Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH. Dr.-Ing. Tilo Landenfeld, 2 Grundlagen des Ottomotors Arbeitsweise Der Ottomotor ist eine Verbrennungs- kraftmaschine mit Fremdzündung, die ein Luft-Kraftstoff-Gemisch verbrennt und Im Arbeitszylinder eines Ottomotors wird damit die im Kraftstoff gebundene chemi- periodisch Luft oder Luft-Kraftstoff-Ge- sche Energie freisetzt und in mechanische misch angesaugt und verdichtet. Anschlie- Arbeit umwandelt. Hierbei wurde in der ßend wird die Entzündung und Verbren- Vergangenheit das brennfähige Arbeitsge- nung des Gemisches eingeleitet, um durch misch durch einen Vergaser im Saugrohr die Expansion des Arbeitsmediums (bei ei- gebildet. Die Emissionsgesetzgebung ner Kolbenmaschine) den Kolben zu bewe- bewirkte die Entwicklung der Saugrohrein- gen. Aufgrund der periodischen, linearen spritzung (SRE), welche die Gemischbil- Kolbenbewegung stellt der Ottomotor einen dung übernahm. Weitere Steigerungen Hubkolbenmotor dar. Das Pleuel setzt dabei von Wirkungsgrad und Leistung erfolgten die Hubbewegung des Kolbens in eine Rota- durch die Einführung der Benzin-Direkt- tionsbewegung der Kurbelwelle um (Bild 1). einspritzung (BDE). Bei dieser Technologie wird der Kraftstoff zum richtigen Zeitpunkt Viertakt-Verfahren in den Zylinder eingespritzt, sodass die Die meisten in Kraftfahrzeugen eingesetzten Gemischbildung im Brennraum erfolgt. Verbrennungsmotoren arbeiten nach dem Viertakt-Prinzip (Bild 1). Bei diesem Ver- fahren steuern Gaswechselventile den La- dungswechsel. Sie öffnen und schließen die Ein- und Auslasskanäle des Zylinders und steuern so die Zufuhr von Frischluft oder -gemisch und das Ausstoßen der Abgase. Das verbrennungsmotorische Arbeitsspiel stellt sich aus dem Ladungswechsel (Aus- schiebetakt und Ansaugtakt), Verdichtung, Bild 1 a Ansaugtakt 1 Das Arbeitsspiel des Viertakt-Ottomotors (am Beispiel eines Motors mit Saugrohreinspritzung und getrennter Ein- und Auslassnockenwelle) b Verdichtungstakt c Arbeitstakt 1 d Ausstoßtakt 2 a b c d 3 1 Auslassnockenwelle 2 Zündkerze 4 3 Einlassnockenwelle 4 Einspritzventil 5 OT Vc 5 Einlassventil 6 6 Auslassventil V s 7 Brennraum 7 h 8 Kolben 9 Zylinder UT 10 Pleuelstange 8 11 Kurbelwelle 9 12 Drehrichtung M Drehmoment 10 αs KKuorlbbeenlwhiunbkel 11 12 M V Hubvolumen h V Kompressions- c volumen © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 K. Reif (Hrsg.), Ottomotor-Management im Überblick, Bosch Fachinformation Automobil, DOI 10.1007/978-3-658-09524-6_1 Grundlagen des Ottomotors Arbeitsweise 3 Verbrennung und Expansion zusammen. erhöht den Druck und die Temperatur der Nach der Expansion im Arbeitstakt öffnen Brennraumladung, was den Kolben abwärts die Auslassventile kurz vor Erreichen des treibt. Nach zwei Kurbelwellenumdrehungen unteren Totpunkts, um die unter Druck ste- beginnt ein neues Arbeitsspiel. henden heißen Abgase aus dem Zylinder strömen zu lassen. Der sich nach dem Arbeitsprozess: Ladungswechsel und Durchschreiten des unteren Totpunkts auf- Verbrennung wärts zum oberen Totpunkt bewegende Kol- Der Ladungswechsel wird üblicherweise ben stößt die restlichen Abgase aus. durch Nockenwellen gesteuert, welche die Danach bewegt sich der Kolben vom obe- Ein- und Auslassventile öffnen und schlie- ren Totpunkt (OT) abwärts in Richtung un- ßen. Dabei werden bei der Auslegung der teren Totpunkt (UT). Dadurch strömt Luft Steuerzeiten (Bild 2) die Druckschwingun- (bei der Benzin-Direkteinspritzung) bzw. gen in den Saugkanälen zum besseren Füllen Luft-Kraftstoffgemisch (bei Saugrohrein- und Entleeren des Brennraums berücksich- spritzung) über die geöffneten Einlassventile tigt. Die Kurbelwelle treibt die Nockenwelle in den Brennraum. Über eine externe Ab- über einen Zahnriemen, eine Kette oder gasrückführung kann der im Saugrohr Zahnräder an. Da ein durch die Nockenwel- befindlichen Luft ein Anteil an Abgas zu- len zu steuerndes Viertakt-Arbeitsspiel zwei gemischt werden. Das Ansaugen der Frisch- Kurbelwellenumdrehungen andauert, dreht ladung wird maßgeblich von der Gestalt der sich die Nockenwelle nur halb so schnell wie Ventilhubkurven der Gaswechselventile, der die Kurbelwelle. Phasenstellung der Nockenwellen und dem Ein wichtiger Auslegungsparameter für Saugrohrdruck bestimmt. den Hochdruckprozess und die Verbren- Nach Schließen der Einlassventile wird die nung beim Ottomotor ist das Verdichtungs- Verdichtung eingeleitet. Der Kolben bewegt verhältnis ε, welches durch das Hubvolumen sich in Richtung des oberen Totpunkts (OT) V und Kompressionsvolumen V folgender- h c und reduziert somit das Brennraumvolu- maßen definiert ist: men. Bei homogener Betriebsart befindet V + V sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch bereits zum ε = _ _h__ __c . (1) V Ende des Ansaugtaktes im Brennraum und c wird verdichtet. Bei der geschichteten Be- Dieses hat einen entscheidenden Einfluss auf triebsart, nur möglich bei Benzin-Direktein- den idealen thermischen Wirkungsgrad η , th spritzung, wird erst gegen Ende des Verdich- da für diesen gilt: tungstaktes der Kraftstoff eingespritzt und somit lediglich die Frischladung (Luft und η = 1 – _ _1_ _ , (2) th ε κ‒1 Restgas) komprimiert. Bereits vor Erreichen des oberen Totpunkts leitet die Zündkerze wobei κ der Adiabatenexponent ist [4]. Des zu einem gegebenen Zeitpunkt (durch Weiteren hat das Verdichtungsverhältnis Fremdzündung) die Verbrennung ein. Um Einfluss auf das maximale Drehmoment, die den höchstmöglichen Wirkungsgrad zu er- maximale Leistung, die Klopfneigung und reichen, sollte die Verbrennung kurz nach die Schadstoffemissionen. Typische Werte dem oberen Totpunkt abgelaufen sein. Die beim Ottomotor in Abhängigkeit der Fül- im Kraftstoff chemisch gebundene Energie lungssteuerung (Saugmotor, aufgeladener wird durch die Verbrennung freigesetzt und Motor) und der Einspritzart (Saugrohrein-
