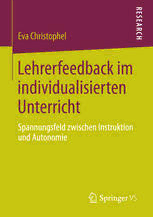
Lehrerfeedback im individualisierten Unterricht: Spannungsfeld zwischen Instruktion und Autonomie PDF
Preview Lehrerfeedback im individualisierten Unterricht: Spannungsfeld zwischen Instruktion und Autonomie
Lehrerfeedback im individualisierten Unterricht Eva Christophel Lehrerfeedback im indi- vidualisierten Unterricht Spannungsfeld zwischen Instruktion und Autonomie Eva Christophel Landau , Deutschland Vom Fachbereich Psychologie der Universität Koblenz- Landau genehmigte Dissertation. Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und F orschung Förderkennzeichen: 01 JH 0919 ISBN 978-3-658-05098-6 ISBN 978-3-658-05099-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-658-05099-3 D ie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio- nalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abufb ar. Springer VS © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 D as Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu- stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über- setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. D ie Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die- sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be- trachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.springer-vs.de Vorwort Vorwort Vorwort Die vorliegende Arbeit basiert auf der Dissertation „Individualisierter Unterricht: Lehrerfeedback im Spannungsfeld zwischen Instruktion und Autonomie“, die anknüpfend an das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför- derte Forschungsprojekt „Diagnostische und didaktische Kompetenz von Lehr- kräften zur Förderung der Text-Bild-Integrationsfähigkeit bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I“ (DIKOL; Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Schnotz und Dr. Christiane Baadte) im Fachbereich Psychologie in der Arbeitseinheit Allgemeine und Pädagogische Psychologie der Universität Koblenz-Landau entstand. Zunächst möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt dabei meinem Betreu- er Prof. Dr. Wolfgang Schnotz für die vertrauensvolle und unterstützende Beglei- tung meines Promotionsvorhabens. Die anregenden und konstruktiven Gespräche mit ihm sowie seine Unterstützung bei theoretischen und praktischen Fragen brachten die Planung und Umsetzung meines Forschungsvorhabens wesentlich voran. Zudem ermöglichte er mir die assoziierte Mitgliedschaft im DFG- Graduiertenkolleg Unterrichtsprozesse der Universität Koblenz-Landau. Ebenso gilt mein Dank meiner Zweitgutachterin Prof. Dr. Renate Rasch, deren reges Interesse an meinem Forschungsvorhaben meine Arbeit sehr unterstützte. Bei Dr. Christiane Baadte bedanke ich mich herzlich für ihre stete Bereitschaft zur anre- genden Diskussion und ihre zahlreichen inhaltlichen und methodischen Hinwei- se, mit denen sie meine Dissertation bereicherte. Außerdem möchte ich mich bei allen gegenwärtigen und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsein- heit Allgemeine und Pädagogische Psychologie der Universität Koblenz-Landau für das konstruktive Arbeitsklima und die hilfreichen Anregungen bedanken. Hervorzuheben sind dabei meine DIKOL-Kollegin Dr. Nora Heyne, die bei den Videoaufnahmen und deren Vorbereitungen mitarbeitete, Dipl.-Psych. Katja Knuth-Herzig, die mir während meiner Dissertationszeit freundschaftlich zur Seite stand, und Dr. Christoph Mengelkamp, dem ich für sein offenes Ohr und seine methodischen Ratschläge danke. Auch den Kolleginnen und Kollegen des DFG-Graduiertenkollegs Unterrichtsprozesse der Universität Koblenz-Landau möchte ich an dieser Stelle für den interessanten Austausch danken. Für die Unterstützung bei den Transkriptionen und der Zuordnung der Kategorien danke ich den studentischen Hilfskräften Elke Benkel, Sabine Boysen, Verena Eichel, 6 Vorwort Franziska Jilg, Isabel Rinck und Christoph Wrobel. Ganz herzlich möchte ich mich bei meinem Mann und meiner Familie bedanken, die mir immer zur Seite standen und deren Verständnis bei der Realisierung dieser Arbeit eine große Unterstützung war. Außerdem danke ich allen Schülerinnen und Schülern, die mit ihrer Teilnahme an den Videoaufnahmen die Erstellung der Videovignetten ermöglichten, und allen Lehrerinnen, Lehrern, Studentinnen und Studenten, die sich, neben ihrem Schul- und Studienalltag, die Zeit nahmen, an meiner Untersu- chung teilzunehmen. Mannheim, im März 2013 Eva Christophel “Perhaps our most important quality as humans is our capability to self-regulate” (Zimmerman, 2000, S. 13). Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... 11 Tabellenverzeichnis ............................................................................................ 13 Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................... 15 1 Einleitung ................................................................................................... 17 2 Lehrerfeedback im individualisierten Unterricht .................................. 23 2.1 Einstellung und Feedbackverhalten .................................................... 24 2.2 Zwei Perspektiven individualisierten Unterrichts ............................... 32 2.2.1 Humanistisch geprägte Sichtweise ............................................. 34 2.2.1.1 Humanismus ................................................................. 34 2.2.1.2 Offener Unterricht ......................................................... 38 2.2.1.3 Reformpädagogische Bezüge ........................................ 40 2.2.1.4 Lehrerrolle und Schülerunterstützung ........................... 45 2.2.2 Kognitiv-konstruktivistisch geprägte Sichtweise ....................... 47 2.2.2.1 Kognitiver Konstruktivismus ........................................ 48 2.2.2.2 Selbstreguliertes Lernen ................................................ 53 2.2.2.2.1 Phasenmodelle ............................................... 57 2.2.2.2.2 Lehrerfeedback zur Unterstützung der Schülerselbstregulation .................................. 59 2.3 Fragestellungen ................................................................................... 68 2.3.1 Resümee aus den vorgestellten theoretischen Hintergründen .... 68 2.3.2 Ziel der Analysen ....................................................................... 71 3 Analyse des Feedbackverhaltens ............................................................. 75 3.1 Instrumente ......................................................................................... 76 3.1.1 Erhebung .................................................................................... 76 3.1.1.1 Fragebogen I ................................................................. 76 3.1.1.2 Videovignetten .............................................................. 77 3.1.1.2.1 Integriertes Modell des Text- und Bildverstehens ............................... 79 3.1.1.2.2 Erstellung und Bearbeitung des Videomaterials ............................................... 83 10 Inhaltsverzeichnis 3.1.1.2.3 Filmauswahl .................................................. 85 3.1.1.2.4 Videoschnitt ................................................... 88 3.1.1.3 Fragebogen II ................................................................ 89 3.1.1.3.1 Theoretische Überlegungen ........................... 90 3.1.1.3.2 Empirische Überprüfung ............................... 91 3.1.2 Auswertung .............................................................................. 109 3.1.2.1 Lernprozessanalyse ..................................................... 111 3.1.2.2 Bestimmung und Analyse des Ausgangsmaterials ...... 117 3.1.2.3 Fragestellung und Analyseschritte .............................. 118 3.1.2.4 Kodierleitfaden ........................................................... 121 3.2 Versuchsplanung ............................................................................... 132 3.2.1 Variablen .................................................................................. 132 3.2.2 Stichprobe ................................................................................ 135 3.2.3 Durchführung ........................................................................... 136 3.2.4 Quantitative Auswertung ......................................................... 137 3.3 Analysen ........................................................................................... 138 3.3.1 Analyse 1: Einstellungs- und Rangzuordnungsunterschiede.... 138 3.3.1.1 Fragestellungen und Hypothesen ................................ 138 3.3.1.2 Ergebnisse ................................................................... 140 3.3.1.2.1 Deskriptive Ergebnisse ................................ 140 3.3.1.2.2 Prüfung der Forschungshypothesen ............. 141 3.3.1.3 Diskussion ................................................................... 143 3.3.2 Analyse 2: Einstellungs-Verhaltenszusammenhang ................ 144 3.3.2.1 Fragestellungen und Hypothesen ................................ 144 3.3.2.2 Ergebnisse ................................................................... 148 3.3.2.2.1 Deskriptive Ergebnisse ................................ 148 3.3.2.2.2 Prüfung der Forschungshypothesen ............. 151 3.3.2.3 Diskussion ................................................................... 171 4 Gesamtdiskussion .................................................................................... 175 4.1 Resümierende Deutung der Resultate ............................................... 178 4.2 Methodische Kritik ........................................................................... 185 4.3 Praktische Implikationen ................................................................... 186 4.4 Ausblick ............................................................................................ 188 Literaturverzeichnis ....................................................................................... 193 Anhang ............................................................................................................. 20(cid:24) Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Im Hinblick auf das MODE-Modell angepasstes Kernmodell der spontanen Verarbeitung (modifiziert nach Fazio, 1986) .... 31 Abbildung 2: Zyklische Phasen der Selbstregulation (Schmitz & Wiese, 2006; Zimmerman, 1998, 2000) ............... 59 Abbildung 3: Modell phasenspezifischer Feedbackarten (modifiziert nach Butler & Winne, 1995; Dweck & Leggett, 1988; Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Kluger & DeNisi, 1996; Narciss, 2006; Schmitz & Wiese, 2006; Vygotsky, 1962; Zimmerman, 1998, 2000) ........................................................................................ 65 Abbildung 4: Screenshot der fertigen Videovignette zur Aufgabe Aufbau einer Pflanzenzelle ................................................................... 78 Abbildung 5: Integriertes Modell des Text- und Bildverstehens von Schnotz und Bannert (1999) .................................................... 81 Abbildung 6: Screenshot der Benutzeroberfläche von MAGIX Video deluxe: Rohdatei zur Aufgabe Aufbau einer Pflanzenzelle ...... 88 Abbildung 7: Zusammenhang zwischen Itemtrennschärfe und -schwierigkeit bei den Items der Skala Einstellung zur Schülerselbstregulation ........................................................... 95 Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Itemstreuung und -schwierigkeit bei den Items der Skala Einstellung zur Schülerselbstregulation ........................................................... 96 Abbildung 9: Zusammenhang zwischen Itemtrennschärfe und -streuung bei den Items der Skala Einstellung zur Schülerselbstregulation ........................................................... 97 Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Itemtrennschärfe und -schwierigkeit bei den Items der Skala Einstellung zur Fremdregulation ...................................................................... 99 Abbildung 11: Zusammenhang zwischen Itemstreuung und -schwierigkeit bei den Items der Skala Einstellung zur Fremdregulation ..... 100 Abbildung 12: Zusammenhang zwischen Itemtrennschärfe und -streuung bei den Items der Skala Einstellung zur Fremdregulation ..... 101
