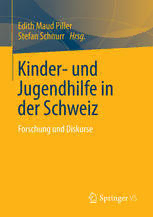
Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz: Forschung und Diskurse PDF
Preview Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz: Forschung und Diskurse
Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz Edith Maud Piller • Stefan Schnurr (Hrsg.) Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz Forschung und Diskurse Herausgeber Edith Maud Piller lic. phil. Prof. Dr. Stefan Schnurr Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für Soziale Arbeit Olten und Basel, Schweiz ISBN 978-3-531-18459-3 ISBN 978-3-531-19061-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-531-19061-7 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio- n a lbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufb ar. Springer VS © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu- stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über- setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die- sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be- trachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.springer-vs.de Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Edith Maud Piller und Stefan Schnurr(cid:3) Forschung zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe – eine Einleitung ........ 7(cid:3) 1(cid:3)Kindesschutz, Heimerziehung und Pflegekinderhilfe(cid:3) Peter Voll und Andreas Jud(cid:3) Management by diffusion? Zum Umgang mit Risiken im zivilrechtlichen Kindesschutz ....................................................................................................... 23(cid:3) Dorothee Schaffner und Angela Rein(cid:3) Jugendliche aus einem Sonderschulheim auf dem Weg in die Selbstständigkeit – Übergänge und Verläufe Anregungen für die Heimpraxis aus der Perspektive von Adressat/innen .......... 53(cid:3) Mandy Schöne, Antje Sommer und Annegret Wigger(cid:3) Vergemeinschaftungsprozesse als vergessene Dimension der stationären Jugendhilfe Eine ethnografische Fallstudie ............................................................................ 79(cid:3) Laurence Ossipow, Gaëlle Aeby und Marc-Antoine Berthod(cid:3) Trugbilder des Erwachsenenlebens Autonomie lernen in sozialpädagogischen Einrichtungen für Minderjährige – eine ethnografische Studie ..................................................... 101(cid:3) Yvonne Gassmann(cid:3) Diversität in der Pflegekinderhilfe Untersuchungen zu Entwicklungsverläufen und zur strukturellen Vielfalt von Pflegeverhältnissen .................................................................................... 129(cid:3) 2(cid:3)Kinder- und Jugendhilfe im Kontext der Schule(cid:3) Rahel Heeg und Florian Baier(cid:3) Wirkungschronologien in der Schulsozialarbeit ............................................... 165 6 Inhaltsverzeichnis Christian Vogel(cid:3) Mythos Kooperation Die Klischierung des Legitimationsproblems in aktuellen Institutionalisierungsformen der Schulsozialarbeit ........................................... 197(cid:3) Caroline Müller, Christoph Mattes, Jutta Guhl und Carlo Fabian(cid:3) Risikoentwicklungen bei Schülerinnen und Schülern frühzeitig erkennen und intervenieren Evaluationen von Pilotprojekten in der Deutschschweiz .................................. 229(cid:3) 3 Ambulante Dienste(cid:3) Éric Paulus, Jean-Pierre Tabin et Bhama Steiger(cid:3) Évaluation de l’action éducative en milieu ouvert dans le canton de Vaud ...... 257(cid:3) 4 Offene Jugendarbeit(cid:3) Renate Gutmann und Julia Gerodetti(cid:3) Offene Jugendarbeit in der Schweiz – Forschung und Entwicklung Ein systematischer Überblick ........................................................................... 269(cid:3) 5 Lebenslagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen(cid:3) Dorothee Schaffner und Matthias Drilling(cid:3) Junge Erwachsene in der Sozialhilfe Folgen veränderter Bedingungen am Übergang in die Erwerbsarbeit .............. 297(cid:3) Elisa Streuli(cid:3) Geld, Knappheit und Verschuldung im Jugendalter Zwischen finanzieller Abhängigkeit und Mündigkeit ....................................... 333(cid:3) 6 Kinder- und Jugendhilfe in historischer Perspektive(cid:3) Gisela Hauss und Béatrice Ziegler(cid:3) Die zunehmende Bedeutung von Körper und Anlage Männliche Jugendliche in den Fallgeschichten der Jugendfürsorge (1920– 1950) ................................................................................................................. 369(cid:3) Verzeichnis der Autorinnen und Autoren ......................................................... 385 Forschung zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe – eine Einleitung 7 Forschung zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe – eine Einleitung Edith Maud Piller und Stefan Schnurr Wie die meisten europäischen Wohlfahrtsstaaten verfügt auch die Schweiz über eine breit ausdifferenzierte und vielfältige Landschaft an Angeboten, Diensten und Einrichtungen, die sich primär an Kinder, Jugendliche und Familien richten und die sich sinnvoll unter dem Begriff der Kinder- und Jugendhilfe einordnen lassen. »Jugendhilfe« ist in offiziellen deutschsprachigen Dokumenten (Geset- zen, Verordnungen) ein breit verwendeter Sammelbegriff, und Google findet zum Stichwort »Jugendhilfe« 47(cid:3031)000 und zum Stichwort »Kinder- und Jugend- hilfe« 25(cid:3031)100 Seiten aus der Schweiz. Wer jedoch in Bibliothekskatalogen nach einem orientierenden Text zum System der schweizerischen Kinder- und Ju- gendhilfe sucht, trifft auf Schwierigkeiten.1 Zu diesem Feld ist bis heute immer noch ausgesprochen wenig gesichertes Wissen verfügbar. Die wichtigsten Grün- de dafür liegen zum einen in den kleinräumigen föderalistischen Strukturen, die es selbst für Verantwortliche und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe schwer machen, einen Überblick zu gewinnen und zu behalten; zum anderen in den Schwerpunktsetzungen jener Institutionen, die auf die Produktion von metho- disch gesichertem Wissen spezialisiert sind: der Hochschulen. Im föderalistischen Bundesstaat Schweiz liegt die Zuständigkeit für Ange- bote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Händen der Kantone und Gemeinden (Bundesrat 2012, S. 38; Piller 2003, S. 7). Soweit bundesrechtli- che Regelungen bestehen, beziehen sich diese nahezu ausschließlich (1) auf den Kindesschutz2 – also den Ernstfall der Kinder- und Jugendhilfe – und regeln hier primär die Voraussetzungen legitimer Eingriffe in das Elternrecht, (2) auf die Aufnahme von Kindern zur Pflege3 und zur Adoption4, (3) auf die Voraussetzun- gen von Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der außerschulischen Bildung 1 Für einen solchen Überblick siehe Piller & Schnurr (2006); Bundesrat (2012). 2 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), Art. 307–317. 3 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) vom 19. Oktober 1977, die zurzeit einer Teilrevision unterzogen wird. 4 Verordnung über die Adoption (AdoV) vom 29. Juni 2011. E. M. Piller, S. Schnurr (Hrsg.), Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz, DOI 10.1007/978-3-531-19061-7_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013 8 Edith Maud Piller und Stefan Schnurr (Jugendarbeit, Jugendpartizipation)5 und auf die Gewährung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen an Personen, »die durch eine Straftat in ihrer körperli- chen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt« wurden.6 Dass Rahmengesetze nur für die genannten Anlässe bzw. Handlungsformen vorliegen, bedingt eine Vielfalt lokaler Institutionalisierungsvarianten und An- gebotslandschaften. Die Schweiz kennt nicht ein System der Kinder- und Ju- gendhilfe, sondern ebenso viele, wie es Kantone gibt, also deren 26, und dies bei einer Bevölkerungszahl von knapp 7,9 Millionen. In 11 der 26 Kantone bestehen eigenständige Gesetze und/oder Verordnun- gen, die mit unterschiedlichen Akzentuierungen Gegenstände der Kinder- und Jugendhilfe (und teilweise Fragen der Mitwirkung von Kindern und Jugendli- chen im Gemeinwesen) regeln (Schnurr 2012, S. 99f.). Ihre wichtigsten Funktio- nen haben diese kantonalen Gesetze darin, dass sie den Aufgaben und Ausgaben des Kantons im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eine rechtliche Grundlage geben, Zuständigkeiten regeln und Grundsätze der Ausführung festhalten. Weiter bestimmen die meisten unter ihnen allgemeine Zielsetzungen der zu fördernden Aktivitäten, benennen Zielgruppen und Handlungsbereiche sowie in einigen Fällen einzelne Hilfeformen. Rechtsansprüche auf Leistungen gewähren sie nur in einigen seltenen Ausnahmen. Die föderalistischen Strukturen setzen sich auf der Ebene der politischen Zuständigkeiten innerhalb der kantonalen Verwaltungen und im Verhältnis der 26 Kantone zu den insgesamt 2495 Gemeinden fort. Heterogenität bestimmt auch die jeweils gewachsenen Trägerlandschaften und die Regeln der Zusam- menarbeit zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern. Entscheidungsstel- len und Zugangskriterien variieren ebenso wie die Verfügbarkeit von Leistungen und die jeweiligen Zugangswege. Folgerichtig zeigt sich Vielfalt auch auf der Ebene der Bezeichnung von Diensten und Leistungsarten. Nicht nur die Land- schaften selbst, auch das Wissen über sie ist durch heterogene politische und auch fachliche Zuständigkeiten in hohem Maße fragmentiert. Expertise ist selbst- redend vorhanden, aber oft ist diese Expertise vergleichsweise eng an jene Ge- biete (Kantone, Regionen), Leistungsarten (z.B. Heimerziehung) oder auch Trä- gerorganisationen gekoppelt, in denen sie angeeignet wurde. Es ist also keines- wegs übertrieben, wenn der Bundesrat in einem aktuellen Bericht feststellt, dass in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe »in der Schweiz keine einheitlichen Definitionen bestehen und ein gemeinsames Verständnis der Kinder- und Ju- 5 Jugendförderungsgesetz (JFG) vom 6. Oktober 1989; ab 1. Januar 2013 abgelöst durch das revidier- te Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG); vgl. dazu den Beitrag von Gutmann und Gerodetti in diesem Band. 6 Art. 1 Opferhilfegesetz (OHG). Forschung zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe – eine Einleitung 9 gendhilfe sowie ein Überblick über die bestehende Kinder- und Jugendhilfeland- schaft fehlt« (Bundesrat 2012, S. III). Eine dringend notwendige Verständigung über unverzichtbare »Grundleistungen der Kinder- und Jugendhilfe«, die in allen Kantonen, Regionen und Gemeinden verfügbar und zugänglich sein sollten, hat gerade erst begonnen (Bundesrat 2012, S. 49ff.; Schnurr 2012, S. 99ff.). Die hier skizzierten Umstände stellen alle Versuche einer Beschreibung und Analyse von Angebots- und Entscheidungsstrukturen vor erhebliche Probleme; diese werden noch dadurch gesteigert, dass die Schweiz vier Amtssprachen kennt. All dies erklärt zu einem guten Teil den immer noch bescheidenen Stand des ver- fügbaren Wissens zur Kinder- und Jugendhilfe der Schweiz. Hinzu kommt – wie oben angedeutet –, dass jene Institute und Lehrstühle an Schweizer Universitäten, die seit den 1970er-Jahren mit der Ausbildung und Forschung zur Sozialarbeit (Freiburg) bzw. Sozialpädagogik (Zürich) befasst waren bzw. sind, ihre Schwer- punkte eher bei theoriegeschichtlichen und systematischen Fragen setzten, sich anderen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit zuwandten oder ihr Interesse an der Kinder- und Jugendhilfe primär auf die außerfamiliäre Erziehung und hier haupt- sächlich auf die Heimerziehung konzentrierten (z.B. Schoch, Tuggener & Wehrli 1989; Tanner 2003). Mit der Einrichtung von Fachhochschulen nach 1995 und der dadurch ausgelösten Entwicklung zahlreicher Ausbildungseinrichtungen der Sozia- len Arbeit von Höheren Fachschulen zu Hochschulen wurden die Voraussetzungen für die allmähliche Herausbildung einer schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe- forschung günstiger. Das Bundesgesetz über die Fachhochschulen vom 6. Oktober 1995 weist diesen einen vierfachen Leistungsauftrag zu, der neben Ausbildung, Weiterbildung und wissenschaftsbasierten Dienstleistungen auch Forschung und Entwicklung umfasst.7 Seit Mitte der 2000er-Jahre nimmt denn auch die For- schung zur Kinder- und Jugendhilfe an Fachhochschulen und Universitäten einen erkennbaren Aufschwung, wobei der größere Teil der Studien bei den Fachhoch- schulen angesiedelt ist. Inzwischen liegen neben einigen historiografischen Arbei- ten (z.B. Leuenberger & Seglias 2008; Wilhelm 2005) auch erste größere empiri- sche Studien zur Entscheidungspraxis bei Fremdplatzierungen (Arnold et al. 2008), zur Praxis im Kindesschutz (Voll et al. 2008), zur Arbeit mit gewaltauffälligen Kindern und Jugendlichen (Wigger, Sommer & Stiehler 2010) und zur Schulsozi- alarbeit (Baier & Heeg 2011) vor. Weiter sind erste, orientierende Sammelbände mit (vorwiegend) forschungsgestützten Beiträgen zum Kindeswohl (Kaufmann & Ziegler 2003) und zu schulnahen Diensten (Baier & Schnurr 2008) erschienen. Der vorliegende Band schließt hier an und präsentiert erstmals eine Samm- lung von Forschungsbeiträgen zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe. Er 7 Für einen Einblick in die Landschaft der von den Hochschulen der Schweiz angebotenen Aus- und Weiterbildung zur Sozialen Arbeit siehe Gredig & Schnurr (2011). 10 Edith Maud Piller und Stefan Schnurr trägt insofern den Charakter einer Werkschau der auf die Schweiz bezogenen Kinder- und Jugendhilfeforschung. Es geht dabei aber um mehr als um die bloße Präsentation von Forschungsergebnissen. Primär will diese Sammlung von Stu- dien dazu beitragen, dass der fachöffentliche Diskurs zur Kinder- und Jugendhilfe durch empirische Grundlagen angereichert wird und weiteren Aufschwung er- fährt. Fachdiskurse und fachpolitische Debatten über Strukturen und Praxen der Kinder- und Jugendhilfe, über das Zusammenspiel von Entscheidungsstellen und Leistungserbringern, über die spezifische Leistungsfähigkeit bestimmter Leis- tungsformen, über Fragen der Wirksamkeit und der Bedarfsgerechtigkeit des Angebots werden immer noch zu wenig geführt. Damit sie nicht im Spekulativen bleiben müssen, brauchen sie eine empirische Basis. Der Band will insofern auch auf die wachsende Nachfrage nach empirisch gesicherten Beschreibungen und Analysen zur Kinder- und Jugendhilfe in Wissenschaft, Praxis und Politik antwor- ten. Viele der hier versammelten Forschungsbeiträge verdanken ihre Herkunft einem intensiven – wenn auch bisweilen kontroversen – Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik und sollen diesen weiter konstruktiv fördern. Schließlich weisen die hier gesammelten Beiträge – in unterschiedlichen Bezügen – immer auch über ihren nationalstaatlichen Herkunftskontext hinaus. Damit sollen sie die Anschlussfähigkeit der Fachdiskurse zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe an andere Kontexte der deutschsprachigen Kinder- und Jugend- hilfeforschung unterstützen. Die Beiträge decken ein weites Spektrum der Kinder- und Jugendhilfe ab. Bei zwei Beiträgen liegt der Akzent auf der empirischen Analyse von Lebensla- gen und Lebensweisen junger Menschen (vgl. unten), auf die Kinder- und Ju- gendhilfe antwortet. Mit wenigen begründeten Ausnahmen folgen die hier ver- sammelten Artikel dem gleichen Aufbau: Zunächst erläutern sie die leitenden Forschungsfragen, dann präsentieren sie Ergebnisse und diskutieren diese jeweils im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Wir geben im Folgenden einen thematisch geordneten Überblick. 1 Zivilrechtlicher Kindesschutz Peter Voll und Andreas Jud präsentieren Ergebnisse aus einem Teil einer umfas- senden Studie, in der die Prozesse und Strukturen im zivilrechtlichen Kindes- schutz in der Schweiz untersucht werden (Voll et al. 2008). In ihrem Artikel un- tersuchen sie die Frage, wie der institutionelle Kontext die Bearbeitung eines Falles strukturiert. Ihr theoretisches wie empirisches Interesse richtet sich auf den Umgang mit Ungewissheit und Risiko, der sich aus dem »doppelten Zukunftsbe- zug« des zivilrechtlichen Kindesschutzes ergibt. Die Studie nutzt die Vielfalt
