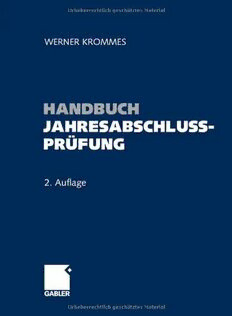Table Of ContentWerner Krommes
Handbuch Jahresabschlussprüfung
Werner Krommes
Handbuch
Jahresabschluss-
prüfung
Ziele | Technik | Nachweise –
Wegweiser zum sicheren Prüfungsurteil
2. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Dr. Werner Krommes verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der nationalen und internationalen
Wirtschaftsprüfung einer großen und renommierten WP-Gesellschaft. Seine langjährigen Erfahrungen
in der Aus- und Fortbildung des beruflichen Nachwuchses u.a. beim Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) und entsprechende Beiträge in Fachzeitschriften fließen in das Werk ein.
Onlineservice: http://www.gabler.de/krommes
1. Auflage 2005
2. Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten
© Gabler | GWVFachverlage GmbH, Wiesbaden 2008
Lektorat: RAAndreas Funk
Gabler ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
www.gabler.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. indiesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Grafik und Buchgestaltung: Felix Brandl·Graphik-Design, München
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt am Main
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Wilhelm &Adam, Heusenstamm
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN 978-3-8349-0481-2
Risikoist ein vergleichsweise moderner Begriff.
Das Wort kommt in der gesamten Literatur der Antike und des
Mittelalters noch nicht vor. Wie viele andere Erkenntnisse ...
erscheint dieser Begriff erstmals in der italienischen
Renaissance. Seefahrer wagten sich über die bekannten
Gewässer des Mittelmeeres hinaus und brachten das Wort
„resciare" in Umlauf. Damals hieß das soviel wie
„eine schwierige Strömung durchqueren."
Benedikt Köhler
(„Rechnen mit dem Unvorhergesehenen")
V
Vorwort Die Anforderungen an den Abschlussprüfer nehmen zu: Die Jahresab-
zur 1. Auflage schlüsse werden komplexer, der Zeitdruck größer und der Blick der Öffent -
lichkeit kritischer.
Im Gegensatz dazu ist die bislang zur Verfügung stehende Literatur äu-
ßerst abstrakt. Schrifttum und Praxis sind weit voneinander entfernt. Es feh-
len anschauliche Beispiele und vor allem Erläuterungen, warumbestimmte
Kenntnisse erforderlich und warumes ganz bestimmte Ziele sind, die die
einzelnen Prüfungshandlungen bestimmen. Mit anderen Worten, es fehlt
an Wegweisern, die den Prüfungspfad markieren und klar benennen, wel-
che Ziele man auf diesem Weg, dem Weg zum Prüfungsurteil, erreichen
muss und wie diese zu gewichten sind.
Das vorliegende Handbuch – verfasst vor dem Hintergrund verschiedener
Unternehmensbilder - hilft Ihnen
die Gesetzmäßigkeiteneiner Abschlussprüfung zu verstehen,
die Eigenarteneines Unternehmens (seiner Geschäftsvorfälle und
seiner Risiken) in Kategorien des Jahresabschlusses umzusetzen und
die Meilensteinezu erkennen, die bei der Prüfung von Jahres-
abschlussposten zu passieren sind, um eine anforderungsgerechte
Arbeit zu gewährleisten.
Das Besondere am Revisionsgeschäftbesteht darin, dass man – vergleichbar
mit Tätigkeiten im Vertrieb – schon sehr früh gezwungen ist, Kontaktezu
Mitarbeitern des Mandanten herzustellen. Man muss vom ersten Tage an
Unterlagen besorgen, sich Dokumente erläutern, Sachverhalte beschrei -
ben und Buchungssätze erklären lassen. Dies gilt – mit unterschiedl ichem
Schwierigkeitsgrad – für die ganze Hierarchie des Prüfungsteams.
Obwohl man Mitglied einer Gruppe ist, bringt es das Tagesgeschäft (für
Prüfungsassistenten eine besondere Herausforderung) mit sich, dass man
seine Arbeiten häufig alleine verrichten muss und dass man deshalb schon
sehr früh kritischen Blicken seiner Gesprächspartner ausgesetzt ist. Es ge-
hört also viel Energie dazu, seine Aufgaben „an der Front“ ordentlich zu er-
füllen.
VI Vorwort
Von Abschlussprüfern nicht entdeckte Bilanzmanipulationenund die damit
verbundene Krise in unserem Berufsstand haben zu einer ernsthaften Be-
sinnung geführt. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer – vom Bilanz -
rechtsreformgesetz, vom Bilanzkontrollgesetz und vom Abschlussprüfer-
aufsichtsgesetz in die Pflicht genommen – sehen sich deutlich höheren
Anforderungen gegenüber, die u.a. in der Einrichtung, Durchsetzung und
Überwachung eines Qualitätssicherungssystems zum Ausdruck kommen.
Es ist damit zu rechnen, dass dieses System auch Regelungen zur Auf-
tragsabwicklung enthalten muss. Wesentlicher Bestandteil dieser Rege-
lungen wird dann auch eine Anleitung des Prüfungsteamssein, um sicher-
zustellen, dass die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt getrof-
fen werden.
Das Handbuch soll dem ganzen Team einen sicheren Einstiegermöglichen
und es bei seiner Arbeit begleiten. Das einzelne Teammitglied soll zu jeder
Zeit in der Lage sein, sich darüber zu informieren, wases machen muss und
warum bestimmte Prüfungsschritte erforderlich sind. Je früher der Ein-
zelne den Weg zum Prüfungsurteilerkennt, desto eher wird er begreifen, wie
wichtig gerade seinBeitrag zu einer effektiven Teamarbeit ist. Dass damit
auch zugleich wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Quali-
tätskontrolleerfüllt werden, bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Der von Vielen geäußerte Wunsch, nachschlagen zu können, wie ein Rah-
men für eine Abschlussprüfung auszusehen hat und was man ganz konkret
tun muss, wenn es gilt, eine bestimmte Jahresabschlussposition zu prü-
fen, hat mich bewogen, dieses Handbuch zu schreiben. Es ist auf die Wirt-
schaftsbereiche „Industrie und Handel“ beschränkt. Themen des Steuer-
rechts werden nicht behandelt.
Es gibt wohl kaum einen Beruf, in dem man sich mit so vielen Charakteren
und unterschiedlichen Eigenschaftenauseinanderzusetzen hat wie im Be-
reich der Wirtschaftsprüfung: Bildung, Kreativität, Fachkenntnis, Fleiß,
Ausdauer, Loyalität, Disziplin und Seriosität einerseits und Flachheit, Inter-
essenlosigkeit, Unkenntnis, Faulheit, Lethargie, Bindungslosigkeit, Rüpel -
haftigkeit, Spekulantentum, Täuschung und Betrug andererseits.
Vorwort VII
Um dem Prüfungsteam das notwendige Rüstzeug mitzugeben, werden des-
halb in diesem Handbuch auch Anregungen gegeben, wie man durch diplo -
matisches Verhalten, durch geschickte Fragestellung bei Gesprächen und
vor allem durch Bestimmtheit im Auftreten sein Ziel (in der Regel ein
„Prüfungs ziel“) am besten erreichen kann.
Zur weiteren Unterstützung seiner Arbeit erhält es darüber hinaus die
Möglichkeit, das Schema bestimmter Anlagen, die sich mit der
Erfassung unternehmerischer Geschäfts- und Kontrolldaten,
Prüfung des internen Kontrollsystems im Anlagengeschäft und der
Qualität von Arbeitspapieren
beschäftigen, im Rahmen eines zusätzlichen kostenlosen Online-Services
unter www.gabler.de/krommes zu nutzen.
Die Arbeit des verantwortungsvollen Abschlussprüfers ist eingebettet in
ein Konzept, das zur Schaffung von Vertrauen überzeugend und zur Be-
herrschung von Risiken wirkungsvoll sein muss. Das vorliegende Hand-
buch soll dazu das entsprechende Instrumentariumliefern.
München, im Mai 2005
Dr. Werner Krommes
Vorwort IX
Vorwort Mit der Präsentation von Unternehmensbildern und Marktlagen – in ihrer
zur natio nalen und internationalen Bandbreite deutlich über die 1. Auflage hinaus -
2. Auflage gehend – wird die Frage verbunden, wodurch die Arbeit des Abschlussp rüfers
jene Wirkungskraft erzielen kann, die die Abgabe eines soliden Gesamt urteils
in Form eines Bestätigungs- oder Versagungsvermerks mit hinreichender
Sicher heit gewährleistet. Es gilt nachzuweisen, dass sie auf einer geregelten
Ordnungvon Prüfungshandlungen beruht. Diese
erhält ihre Konturendurch die Auffächerung des allgemeinen Prüfungs-
ziels (Bestätigung der Verlässlichkeit von in Jahresabschluss und
Lagebericht enthaltenen Informationen),
bekommt ihre Prägungdurch die Notwendigkeit, sich in Anbetracht
laufender Veränderungen auf die abnehmende Verfallzeit von in
früheren Prüfungen gewonnenen Erkenntnissen einzustellen,
gewinnt ihre Stabilitätdurch jeweils sachgerechte Verbindungen
zwischen individuellem Prüfungsziel und spezieller Prüfungstechnik
und
wird bestimmt durch den typischen Maßstab, dass im Rahmen handels-
und berufsrechtlicher Bestimmungen ein dem Abschlussprüfer
entgegengebrachtes Vertrauen nicht delegierbar ist.
Die Berichte über Schwachstellen in internen Kontroll- und Risikofrüherken-
nungssystemen halten an. Außerdem ist zu erkennen, dass diese Systeme
regel mäßig durch Eingriffe einer unter Erfolgsdruck stehenden Geschäfts-
leitung außer Kraft gesetzt werden. Es war deshalb vor dem Hintergrund einer
wachsenden Bedeutung der Kenntnisse über das Unternehmen, seine Cor po -
rate Governance und sein wirtschaftliches und rechtliches Umfeld erforder-
lich, die Eigenartendieser (labilen) Systeme und ihre Anfälligkeiten für Unregel -
mäßigkeiten und Verstöße näher zu beschreiben.
Im Hinblick auf die zunehmende Komplexität der Geschäftstätigkeit und das
erweiterte Spektrum von den Jahresabschluss bedrohenden Risiken musste
darüber hinaus auf Probleme hingewiesen werden, mit denen der Abschluss -
prüfer im Bewusstsein seines Entdeckungsrisikos rechnen muss und wie er
sie in „schwierigen Strömungen“ lösen kann. In diesem Rahmen wurde dann
auch dem Prüfungsbericht selbst und der ihn grundsätzlich flankierenden
Berichts kritikkonsequenterweise ein höherer Stellenwert eingeräumt.
München, im Juni 2008
Dr. Werner Krommes
X
Inhaltsverzeichnis
I. Grundlagen 1
1 Entwicklung und Lage des Berufsstandes ____________________________________ 1
1.1. Die Aufgaben der Abschlussprüfung 1
1.2. Das Berufsrecht, die Stellung des Wirtschaftsprüfers und die Rolle seines Urteils 5
1.2.1 Die Entwicklung des Berufsrechts 5
1.2.2 Das Berufsbild und die Aufgaben des Wirtschaftsprüfers 6
1.2.3 Berufspflichten 6
1.3 Qualitätssicherung als zentrales Thema 12
1.4 Die Bedeutung der Eigenverantwortlichkeit 12
1.4.1 Die Eigenverantwortlichkeit als „Prima inter Pares“ 12
1.4.2 Der Stellenwert des Vertrauens auf Prüfung und Testat 13
2 Prüfungstheoretischer Rahmen _____________________________________________ 16
2.1 Untersuchungs- und Aussagebereiche 16
2.1.1 Messtheoretischer Ansatz 16
2.1.2 Regelungstheoretischer Ansatz 18
2.1.3 Spieltheoretischer Ansatz 19
2.1.4 Verhaltensorientierter Ansatz 21
2.1.5 Vergleichende Betrachtung 21
2.2 Die geregelte Ordnung von Prüfungshandlungen 22
2.2.1 Die Bestimmung der Arbeitsbereiche 22
2.2.2 Prüfungsziele und Prüfungstechnik als strategische Einheiten 23
3 Die Einschätzung des Prüfungsauftrages vor dem Hintergrund
der beruflichen Anforderungen _____________________________________________ 26
3.1 Die Komplexität unternehmerischer Betätigung 26
3.2 Das Prüfungsrisiko und seine Komponenten 27
3.2.1 Allgemeines 27
3.2.2 Das inhärente Risiko 28
3.2.2.1 Die Anfälligkeit von Bilanzpositionen 28
3.2.2.2 Das inhärente Risiko beeinflussende Faktoren 33
3.2.3 Das Kontrollrisiko 37
3.2.4 Das Entdeckungsrisiko 38
3.2.5 Die Bedrohung des Jahresabschlusses 42
4 Das Konzept einer risikoorientierten Abschlussprüfung ________________________ 44
4.1 Die Phasen der Abschlussprüfung und ihre konstituierenden Elemente 44
4.1.1 Die Analyse der Geschäftstätigkeit 44
4.1.1.1 Bestimmungsfaktoren für die Bedeutung von Geschäftsvorfällen 44
4.1.1.2 Die Aufklärungsarbeit des Abschlussprüfers 54
4.1.1.3 Unternehmensziele und Unternehmensrisiken 58
4.1.2 Die Analyse unternehmerischer Kontrollen 59
4.1.2.1 Das Okavango-Phänomen 59
4.1.2.2 Die Auffächerung des generellen Prüfungsziels 62
4.1.3 Die verbleibenden aussagebezogenen Prüfungshandlungen 64
4.1.4 Der Bestätigungsvermerk als abschließendes Urteil 65
4.2 Die Leitfunktion des „Business Understanding“ 66
4.3 Unternehmensbilder: Branchen, Märkte, Länder 68
4.4 Die Rolle des Prüfungsassistenten im Prüfungsteam 75
Inhaltsverzeichnis XI
II Die Felder der Risikoorientierung 79
1 Die Analyse der Geschäftstätigkeit und des Umfeldes der Unternehmung ________ 79
1.1 Segmente des Business Understanding 80
1.1.1 Auf den Markt gerichtete Aktivitäten 80
1.1.1.1 Die Erfassung abschlussrelevanter Daten 80
1.1.1.2 Die Identifikation von Geschäftsvorfällen und Geschäftsprozessen 88
1.1.2 Die Elemente des Innenlebens einer Unternehmung 96
1.1.2.1 Bestandteile des Management-Prozesses 96
1.1.2.2 Die Problematik des „Financial Reporting Environment“ 101
1.2 Die Geschäftsrisiken und ihr Einfluss auf den Jahresabschluss 103
1.2.1 Aspekte der Bedrohung 104
1.2.1.1 Kristallisationspunkte 104
1.2.1.2 Beurteilung von Geschäftsrisiken beim Einsatz von IT 107
1.2.1.3 Überraschungsmomente 109
1.2.2 Abwehrmechanismen 110
1.2.2.1 Das Diagnoseverfahren 111
1.2.2.2 Ausstrahlung auf das Rechnungswesen 115
1.2.3 Strukturbestimmung im Musterfall (WELOS) 116
1.2.3.1 Die logische Kette „Ziele-Strategien-Risiken“ 116
1.2.3.2 Wegweiser für die Abschlussprüfung (Formatierungen) 117
2 Die Analyse der unternehmerischen Kontrollen _______________________________ 126
2.1 Die Entstehungsgeschichte einer Bilanzposition (Die genetische Prägung) 127
2.1.1 Das Denken in Prozessen 127
2.1.2 Kontrollen zur Sicherung der Abschlussaussagen 130
2.2 Ziele, Regeln und Grenzen des Internen Kontrollsystems 133
2.2.1 Die Aufgaben des Internen Kontrollsystems 133
2.2.2 Die Anfälligkeit von internen Kontrollsystemen 136
2.2.2.1 Allgemeine Schwachstellen 136
2.2.2.2 Freiräume 138
2.2.3 Hindernisse für die Entfaltung des Internen Kontrollsystems 142
2.2.3.1 Eindämmung des Informationsflusses 142
2.2.3.2 Machtverhältnisse 142
2.2.4 Erkenntnisgewinne für den Abschlussprüfer 145
2.2.4.1 Die Kategorisierung von Abschlussthemen 145
2.2.4.2 Besinnung auf das Prüfungsrisiko 146
2.2.5 Die Auswahl von Kontrollstellen 147
2.2.5.1 Das Spektrum von Kontrollstellen 147
2.2.5.2 Prozessverbindungen und ihr Einfluss auf den Jahresabschluss 148
2.2.5.3 Die Optimierung des Auswahlprozesses 150
2.2.6 Die Bestimmung des Prüfungspfades 151
2.3 Die Ausrichtung von Geschäftsprozessen 153
2.3.1 Die Kennzeichen eines Prozesses 153
2.3.1.1 Rahmenbedingungen 153
2.3.1.2 Prozess-Ziele 154
2.3.1.3 Prozess-Verrichtungen 157
2.3.1.4 Leistungskennziffern als Maßstab für den Prozess-Erfolg 158
2.3.1.5 Informationstechnologie 162
2.3.2 Die Entwicklung von Prüfungszielen aus der Systematik unternehmerischer Kontrollen 164
2.4 Testen unternehmerischer Kontrollen 169
2.4.1 Die Abschlussaussagen als Basis (Das VEBBAG-Konzept) 169
2.4.2 Die 2-Stufen-Regelung: Design-Test und Funktionstest 170
2.4.3 Die Arten von Kontrollen 171
2.4.4 Kursbestimmung durch die Leitfunktion des Business Understanding 174
2.4.5 Die Behandlung von Fehlern 179