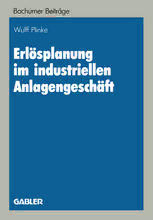
Erlösplanung im industriellen Anlagengeschäft PDF
Preview Erlösplanung im industriellen Anlagengeschäft
Plinke Erlosplanung im industriellen Anlagengeschiift Bochumer Beitrage zur Unternehmungsfiihrung und U nternehmensforschung Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Besters Prof. Dr. Walther Busse von Colbe Prof. Dr. Werner Engelhardt Prof. Dr. Arno Jaeger Prof. Dr. Gert LaBmann Prof. Dr. Wolfgang MaBberg Prof. Dr. Eberhard Schwark Prof. Dr. Rolf Wartmann Band 28 Institut fUr Unternehmungsfiihrung und Unternehmensforschung der Ruhr-Universitat Bochum Prof. Dr. Wulff Plinke Erl6splanung im industriellen Anlagengeschaft GABLER CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Plinke, Wulff: Erlosplanung im industriellen Anlagengeschiift / Wulff Plinke. - Wiesbaden : Gabler, 1985. - (Bochumer Beitriige zur Unternehmungsfiihrung und Unternehmensforschung ; Bd. 28) NE:GT Unveriinderter Nachdruck 1986 © Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, 1985 Druck und Buchbinderei: Lengericher Handelsdruckerei, Lengerich Aile Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfaltigung des Werkes (Fotokopie, Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. ISBN-13: 978-3-409-13230-5 e-ISBN-13: 978-3-322-87934-9 DOT: 10.1007/978-3-322-87934-9 Vorwort Das Rechnungswesen ist die Keimzelle der Betriebswirtschaftslehre. Durch die Entwicklung problemadaquater Abbildungen von Betriebsvorgangen im Externen und Internen Rechnungswesen wurde die. Betriebswirtschaftslehre zur wissen schaftlichen Disziplin. Der Ausbau des ursprunglich vor allem Kontrollzwecken dienenden I nstrumentariums zu einem eben so komplexen wie umfassenden, in ternen wie extern en Anspruchen genugenden System zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Unternehmungen spiegelt den Weg, den die Betriebswirt schaftslehre gegangen ist. Obwohl wir heute vor einem im ganzen durchaus geschlossenen Gesamtgebaude des Rechnungswesens stehen, sind nach wie vor Teile dieses Systems unter entwickelt. Bei der Losung bestimmter Teilfragen treten Schwachen zutage, die sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Standpunkt aus zu bedauern sind. Ohne Anspruch auf Volistandigkeit zu erheben, seien hier einige der gravierenden Schwachpunkte des Internen Rechnungswesens ge nannt: Von den beiden Teilbereichen des Internen Rechnungswesens, der Kosten und der Leistungsrechnung, ist der erste unverhaltnismaBig starker ent wickelt worden als der zweite. Die Leistungs- oder Erlosrechnung hat. nicht die gleiche Beachtung gefunden wie die Kostenrechnung. Eine Erklikung dafUr ergibt sich weitgehend aus historischen Gegebenheiten der Entwick lungszeit des Internen Rechnungswesens. In einer sehr stark vom Markt und seinen Wettbewerbsvorgangen gepragten modernen Wirtschaft ist diese einseitige Ausrichtung nicht mehr vertretbar. Das Interne Rechnungswesen bedient sich bisher in uberwiegendem MaBe des Modells der Serien- bzw. der Sortenfertigung. Damit ruckt die pe riodenbezogene Betrachtung in den Mittelpunkt. Je starker eine auftrags individuelle Einzelfertigung fUr bestimmte I ndustriezweige relevant wurde, desto schmerzlicher wurde das Fehlen eines diesen Produktions- und Ab satzprozessen adaquaten Instrumentes imRechnungswesen bemerkbar. Die periodenbezogene Betrachtung bedarf einer Erganzung durch einen auf Projekte ausgerichteten Kal kul. Die traditionelle Kostenrechnung entstand als Begleitrechnung zur Produk tion. I hr Aufbau als Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostentragerrech nung spiegelt diesen Zweck deutlich wider. Damit beziehen sich die Pla nungs-, Steuerungs- und Kontrollmoglichkeiten vor allem auf die Phase der Leistungserstellung im engeren Sinne. Unter Einbeziehung der Erlose endet II die Rechnung als Produkt- bzw. als Produktgruppenerfolgsrechnung. Auf diese Weise werden die Anforderungen, die unter absatzwirtschaftlichen Gesichtspunkten an das Rechnungswesen gestellt werden, nur teilweise erfUlit. Hier geht es vor allem darum, die einzelnen Marktsegmente unter verschiedensten Einteilungsgesichtspunkten auf ihre Erfolgswirksamkeit zu untersuchen und mit Hilfe der so gewonnenen I nformationen die Steuerung der Absatzpoliti k zu verbessern. Die vorliegende Arbeit setzt an diesen drei Schwachpunkten des Internen Rechnungswesens an. Sie entwickelt ein System der Erlosplanung als Teil der Leistungsrechnung und erganzt damit die traditionelle Kostenbetrachtung. Den Gegenstand der Untersuchung bilden die auftragsindividuellen Einzelfertigun gen, die insbesondere im Anlagen- und Systemgeschaft dominieren. Dabei wird nicht nur das einzelne Projekt in die Betrachtung einbezogen, sondern es wird daneben eine projektUbergreifende, die verschiedenen Geschafte zusam menfassende und miteinander in Verbindung bringende Rechnung entwickelt. Das System wird schlieBlich als Instrument zur UnterstUtzung absatzpoliti scher Entscheidungen konzipiert. Es wird nach den Entscheidungsproblemen in den verschiedenen Phasen des Geschaftes - Angebots-, Verhandlungs- und Abwicklungsphase - differenziert, um den Entscheidern die jeweils notwendi gen Informationen zu geben und ihre Handlungsmoglichkeiten zu verbessern. Dabei werden verhaltenswissenschaftliche Aspekte in die Betrachtung einbe zogen und untersucht, welcher EinfluB vom Rechnungswesen auf die Entschei dungen ausgeht. Die Arbeit eroffnet der Betriebswirtschaftslehre im allgemeinen, dem Internen Rechnungswesen und der Absatzwirtschaft im besonderen neue Perspektiven. Sie vervollstandigt das Instrumentarium zur Abbildung und Steuerung be trieblicher Prozesse in einem Bereich, in dem die Unvollstandigkeit und Ein seitigkeit des Rechnungswesens besonders schmerzlich empfunden wurde. Mit wachsender Bedeutung des Anlagen- und Systemgeschafts wurde es immer dringlicher, Entscheidungshilfen zu entwickeln, die den Besonderheiten dieses Geschaftszweiges gerecht werden. Das theoretische I nteresse an einer Ausful lung weiBer Felder auf der wissenschaftlichen Landkarte verbindet sich mit der Notwendigkeit, praktische Hilfen zur Losung konkreter Fragen eines be stimmten Wirtschaftszweiges zu geben. Die Arbeit verbindet diese beiden An spruche in idealer Weise: Sie entwickelt ein theoretisches Konzept, das einen wichtigen Baustein zur Theorie des Rechnungswesens darstellt, und macht gleichzeitig interessante Vorschlage zur Verbesserung der Entscheidungssi tuation in der Praxis. Damit erbringt sie einen Beitrag, der den Anspruchen einer angewandten Wissenschaft in besonders hohem MaBe entspricht. Die Fakultat der Abteilung fUr Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universitat Bochum hat die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft groBzugig gefor derte Arbeit als Habilitationsschrift angenommen. Prof. Dr. Werner H. Engelhardt III Inhalt Vorwort Verzeichnis der Abbildungen VI Verzeichnis der Tabellen IX Verzeichnis der AbkGrzungen XI 1. EinfGhrung 1.1. Abgrenzung des Untersuchungsfeldes 1.2. Erlos, Erlosrechnung und Erlosplanung 5 1.3. Die zeitliche und sachliche Struktur des Planerloses 7 2. Die Ermittlung des Planerloses in der Angebotsphase 13 2.1. Der konzeptionelle Ausgangspunkt der Erlosplanung in der Angebotsphase 13 2.2 Kosten als informatorische Basis der Erlosplanung in der Phase 1 16 2.2.1. Das Fazit des Literaturstreits um die Eignung von Kosteninformationen fUr Preisentscheidungen 16 2.2.2. Die Einbindung des wertmaBigen Kostenbegriffs in den Ausgaben-Einnahmen-Zusammenhang 22 2.3. Die EinfluBgroBen des Planerloses in der Phase 26 2.4. Der Aufbau eines Planerloses in der Phase 1 30 2.4.1. Die Differenzierung von Angebotsformen als Ant- wort auf die Komplexitat der Planung 30 2.4.2. Erlosplanung bei Schatz-, Richt- und Pro-Forma- Angeboten 31 2.4.3. Erlosplanung bei Festangeboten 32 2.4.3.1. Der Grundansatz 32 2.4.3.2. Erlosplanung auf der Grundlage von Kostenfun ktionen 33 2.4.3.3. Erlosplanung auf der Grundlage des zeit- strukturierten Mengengerusts von Einzel kosten 34 2.4.3.4. Vergleich der vorgestellten Modellansatze 36 IV 2.4.3.5. Die Planung des Deckungsbedarfs fUr Einzelkosten 38 2.4.3.6. Die Planung des Deckungsbedarfs fUr Gemeinkosten 39 2.4.3.6.1. Die Grenzen des periodenorientierten Kalkulationsmodells bei der Planung von Projekterlosen 39 2.4.3.6.2. Die Erganzung der periodenbezogenen Rech- nung um ein projektorientiertes Rechnungs- wesen (POR) 41 2.4.3.6.2.1. Die Grundstruktur des POR 41 2.4.3.6.2.2. Die Bestimmung des Normaldeckungsbedarfs 49 2.4.3.7. Der Nominalwert und der Barwert des Plan- erloses 52 2.4.3.8. Die Einbeziehung marktbedingter Planerlos- begrenzungen 54 2.4.3.9. Die Rolle des Gewinnzuschlags bei der Bildung des Planerloses I 57 2.4.3.10. Die Festlegung der Angebotspreisforderung 61 3. Die Ermittlung des Planerloses in del' Verhandlungsphase 63 3.1. Die EinfluBgroBen des Planerloses in del' Phase 2 63 3.2. Die Rolle des Akquisiteurs bei del' Erlosplanung 67 3.2.1. Personenbedingte EinfluBgroBen des Verhandlungs- verhaltens 67 3.2.2. Umweltbedingte EinfluBgroBen des Verhandlungs- verhaltens 70 3.2.2.1. Merkmale der Aufgabe: Der EinfluB der Kom- plexitat auf das Verhalten des Akquisiteurs 70 3.2.2.2. Merkmale der Verhandlungssituation: Der EinfluB des Preisdrucks auf das Verhalten des Akquisiteurs 73 3.2.2.3. Merkmale der Organisation: Der EinfluB des Deckungsdrucks auf das Verhalten des Akquisiteurs 77 3.2.3. Das Dilemma des Akquisiteurs 78 3.3. Kosteninformationen als Verteidigungslinie gegen den Preisdruck 85 3.3.1. Der Stand der betriebswi rtschaftlichen Aussagen zur Rolle der Kosten bei Entscheidungen unter Preisdruck 85 3.3.1.1. Die entscheidungslogische Betrachtungsweise 85 3.3.1.2. Der Streit um das fUr Entscheidungen unter Preisdruck adaquate Kostenrechnungssystem 88 3.3.1.2.1. Die Dimensionen der Kosteninformation 88 3.3.1.2.2. Die semantische Kritik der Kosteninformation 89 3.3.1.2.3. Die pragmatische Kritik der Kosteninformation 91 3.3.2. Die Wirkung von Kosteninformationen auf das Entscheidungsverhalten unter Preisdruck 92 3.3.2.1. Kosten als EinfluBgroBe des wahrgenommenen Deckungsdrucks 92 3.3.2.1.1. Die Bedeutung von Wahrnehmung, Denken und Lernen fUr das Verhalten gegenuber der Kosteninformation 92 v 3.3.2.1.2. Die Bedeutung der Motivation fUr das Ver- halten gegenuber der Kosteninformation 95 3.3.2.1.3. Die Bedeutung der Einstellung fUr das Verhalten gegenuber der Kosteninformation 98 3.3.2.2. Der EinfluB der Kosteninformation auf das individuelle Entscheidungsverhalten unter Preisdruck. Eine empirische Untersuchung des Kosten-Preis-Effekts 102 3.3.2.2.1. Bisherige Untersuchungen 102 3.3.2.2.2. Die Untersuchungshypothesen 104 3.3.2.2.3. Die Untersuchungsanordnung 105 3.3.2.2.4. Die Ergebnisse 106 3.3.2.2.5. Die Einstellung zur Deckungsdringlichkeit der Kostenarten 116 3.3.2.2.6. Die "personliche Verhaltenstendenzll des Akquisiteurs als erklarende Variable des Preisverhaltens 123 3.3.3. Organisatorische Verstarker des von der Kostenin- formation ausgehenden Deckungsdruckes 134 3.3.3.1. Problemstellung 134 3.3.3.2. Die Gestaltung der Kosteninformation 134 3.3.3.3. Die Kompetenz zur Entscheidung uber das Verhand I ungsergebn i s 135 3.3.3.4. Die Deckungsverantwortlichkeit des Akquisiteurs 136 3.3.4. Das Verhaltnis von Preisdruck und Deckungsdruck: Eine SchluBfolgerung 138 3.4. Die Erfassung von DeckungslUcken im projektorientierten Rechnungswesen: Vom Planerlos I zum Planerlos II 139 4. Die Fortschreibung des Planerloses in der Abwicklungsphase 147 4.1. Die EinfluBgroBen des Planerloses in der Phase 3 147 4.2. Vertraglich bedingte Kostenuberwalzung als Ursache der Erlosfortschreibung 150 4.3. Risiko-Handhabung und Erlosplanung in der Phase 3 153 4.4. Die endgUltige Realisation des Erloses: Der I sterlos 165 5. Das projektorientierte Rechnungswesen als Instrument der strategischen Planung und Kontrolle 167 Literaturverzeichnis 173 Anhang VI Verzeichnis der Abbildungen Abb.1.1 Phasenstruktur im Anlagengeschaft 8 Abb.1.2 Die sachliche Struktur des Planerloses: Die Gliederung des Planerloses nach Planerlosarten 12 Abb.2.1 Preiszuschlagsfunktion (EDELMAN) 14 Abb.2.2 Struktur des Entscheidungsprozesses uber die Angebotsabgabe 15 Abb.2.3 EinfluBgroBen des Planerloses I: Deckungsbedarf fUr Einzelkosten 27 Abb.2.4 EinfluBgroBen des Planerloses I: Deckungsbedarf fUr Gemeinkosten 27 Abb.2.5 EinfluBgroBenhierarchie fUr Walzenzapfenlagerungen 28 Abb.2.6 Abweichungen zwischen Angebots- unci Nachkalkulations werten fUr die Herstell kosten 29 Abb.2.7 Entwicklungstendenzen von Angeboten und Auftrags rate am Beispiel eines Maschinenbauunternehmens 30 Abb.2.8 Gliederungsstammbaum einer SpritzgieBmaschine 34 Abb.2.9 Entwicklung des I nformationsstandes in Abhangigkeit von der Kaufklasse 35 Abb.2.10 Planungsbereiche der vorhandenen Modellansatze zum Aufbau des Planerloses I 37 Abb.2.11 Grundschema der Kal kulation im periodenorientierten betrieblichen Rechnungswesen 40 Abb.2.12 Grundschema der Kal kulation im erweiterten betrieblichen Rech~ungswesen (I) 43 Abb.2.13 Grundschema der Kalkulation im erweiterten betrieblichen Rechnungswesen (II) 44 Abb.2.14 Definition des Planerloses 54 Abb.2.15 Zeitlicher Veri auf kumulierter Ausgaben und Einnahmen 57 Abb.2.16 Auswirkungen unterschiedlicher Kosten- und Gewinn anlastungsverfahren 60 Abb.3.1 EinfluBgroBen des Planerloses II aus der Sicht des einzelnen Akquisiteurs 65 Abb.3.2 EinfluBgroBen des Planerloses II aus dler Sicht der UnternehmensfUhrung 66
