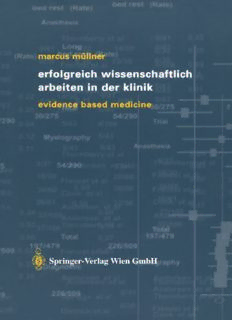
Erfolgreich wissenschaftlich Arbeiten in der Klinik: Evidence Based Medicine PDF
Preview Erfolgreich wissenschaftlich Arbeiten in der Klinik: Evidence Based Medicine
Marcus Müllner Erfolgreich wissenschaftlich Arbeiten in der Klinik Evidence Based Medicine Springer-Verlag Wien GmbH Ao. Univ.-Prof. Dr. Marcus Müllner Universitätsklinik für Notfallmedizin, AKH Wien, Österreich Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. © 2002 Springer-Verlag Wien Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag/Wien 2002 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Produkthaftung: Sämtliche Angaben in diesem Fachbuch/wissenschaftlichen Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Insbesondere Angaben über Dosie rungsanweisungen und Applikationsformen müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eine Haftung des Autors oder des Verlages aus dem Inhalt dieses Werkes ist ausgeschlossen. Satz: H. Meszarics • Satz & Layout • A-1200 Wien Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier - TCF SPIN: 10847658 Mit 25 Abbildungen ISBN 978-3-211-83809-9 ISBN 978-3-7091-3755-0 (eBook) DOI 10.1007/978-3-7091-3755-0 Die Deutsche Bibliothek - CIP Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhältlich Inhaltsverzeichnis Danksagung XIII Wozu ist dieses Buch überhaupt gut? Abschnitt I - Grundlagen des Studiendesign 5 Kapitell: Klinische Epidemiologie - eine Art Einleitung 7 Kapitel 2: Das Studienprotokoll 11 l. Die Basis 11 1.1 Was genau ist die Fragestellung? 11 1.2 Ist die Fragestellung wichtig? 11 1.3 Ist diese Frage bereits ausreichend beantwortet? 12 1.4 Ist das Studiendesign, oder die wissenschaftliche Methode geeignet um diese Frage zu beantworten? 12 1.5 Habe ich (bzw. das Team) die Ressourcen (finanziell, technisch, räumlich, personell) und das Wissen um die Frage zu beantworten? 12 2. Ein Grundgerüst für ein klinisch-medizinisches Studienprotokoll 12 2.1 Zum Titel 12 2.2 Wer ist Autor? 12 2.3 Die Methoden 14 2.4 Das Studiendesign 14 2.5 Studienort-und Population 14 2.6 Studienvorgänge/Datenerhebung 14 3. Registrierung eines Studienprotokolls 15 Kapitel 3: Über Risikofaktoren und Endpunkte 17 1. Was ist ein Risikofaktor? 17 1.1 Wie werden Risikofaktoren am besten erfasst? 18 2. Was ist ein Endpunkt? 18 2.1 Primärer Endpunkt und sekundäre Endpunkte 20 2.2 Kombinierte Endpunkte 20 3. Die Messung von Risikofaktoren und Endpunkten 20 4. Besondere Endpunkte 21 4.1 Mortalität 21 4.2 Morbidität 21 4.2.1 Inzidenz Risiko 22 4.2.2 Inzidenz Rate 22 4.2.3 Prävalenz 22 5. Der Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Endpunkten 23 Kapitel 4: Fragebogen und Interview 25 1. Wozu Fragebögen und Interviews? 25 2. Der Fragebogen 26 2.1 Inhaltliche Regeln (Tabelle 1) 26 VI Inhaltsverzeichnis 2.2 Formale Regeln 27 2.3 Testung, Anpassung, Validierung 27 3. Das Interview 29 4. Das telefonische Interview 30 5. Verbesserung der Response Rate 31 6. Weiterführende Literatur 31 Kapitel 5: Die biometrische Messung 33 1. Allgemeines 33 2. Ein spezielles Beispiel (Blutdruckmessung) 34 2.1 Welche Methode verwende ich am besten? 35 3. Wiederholbarkeit einer Messung 36 4. Wie erfasse ich die Gültigkeit einer Methode? 36 4.1 Die Validierung eines kontinuierlichen Parameters 37 4.2 Die Validierung eines klinischen Tests 38 4.3 Die Anwendung eines klinischen Tests 41 4.4 Was ist Screening? 42 5. Was mache ich, wenn meine Methode ungenau ist? 43 6. Weiterführende Literatur 43 Kapitel 6: Was heißt eigentlich Risiko? 45 1. Hintergrund 45 2. Relatives Risiko und absolutes Risiko 46 2.1 Mehr zum relativen Risiko: Was sind Risk Ratio, Odds Ratio, und Rate Ratio? 47 2.1.1 Risk Ratio 47 2.1.2 Odds Ratio 48 2.1.3 Rate Ratio 48 2.2 Der Zusammenhang zwischen Odds Ratio, Risk Ratio, und Rate Ratio 50 Kapitel 7: Die Freunde des Epidemiologen: Zufallsvariabilität, Bias, Confounding und Interaktion 53 1. Zufallsvariabilität 53 2. Bias 54 2.1 Information Bias 54 2.2 Selection Bias 54 2.3 Vermeidung von Bias 55 3. Confounding 55 3.1 Wie geht man mit Confounding um? 56 3.1.1 Vermeidung von Confounding in der Planungsphase 56 3.1.2 Berücksichtigung von Confounding im Rahmen der Analyse 57 4. Interaktion 58 Kapitel 8: Verblindung und Bias 59 1. Wir sehen nur was wir sehen wollen 59 2. Verblindung bei Fall-Kontroll Studien 60 3. Verblindung bei Kohortenstudien 60 4. Verblindung bei randomisierten, kontrollierten Studien 61 4.1 Verblindung vor der Randomisierung 61 4.2 Verblindung der Patienten 61 4.3 Verblindung bei der Messung des Endpunktes 62 5. Weiterführende Literatur 64 Inhaltsverzeichnis VII Kapitel 9: Beobachtungsstudien 65 1. Fallbericht und Fallserie 65 1.1 Wozu braucht man Fallberichte und Serien? 65 1.2 Nachteile 66 2. Querschnittstudie (auch "cross sectional"-, oder Prävalenzstudie) 66 2.1 Wozu braucht man Querschnittsstudien? 67 2.2 Nachteile 67 3. Hypothesen formulieren - Hypothesen beweisen 68 Kapitel 10: Fall-Kontroll-(Case-Control-J Studie 69 1. Allgemeines 69 2. Auswahl der Fälle 71 3. Auswahl der Kontrollen 71 3.1 Patienten mit anderen Erkrankungen 71 3.2 Zufalls stichprobe aus der Bevölkerung 72 3.3 Freunde bzw. Verwandte des "Falles" 72 4. Wozu braucht man Fall-Kontrollstudien? 73 5. Nachteile und Schwachstellen der Fall-Kontrollstudie 73 5.1 Bias 73 5.2 Zeitlicher Zusammenhang zwischen Risikofaktor und Auftreten des Endpunktes 73 5.3 Seltene Risikofaktoren 74 5.4 Qualität der Daten 74 5.5 Inzidenz und Prävalenz der Erkrankung 74 6. Weiterführende Literatur 74 Kapitel 11: Die Kohortenstudie 75 1. Allgemeines 75 2. Prospektiv oder retrospektiv? 77 3. Wozu braucht man Kohortenstudien? 77 4. Nachteile und Schwachstellen der Kohortenstudie 77 4.1 Seltene Endpunkte 77 4.2 Aufwand und Kosten 77 4.3 Kausalität 78 4.4 Bias 78 Kapitel 12: Wie weist man die Wirksamkeit von medizinischen Interventionen nach? 81 1. Allgemeines 81 2. Wie erstellt man Kontrollgruppen? 82 2.1 Historische Kontrollen 82 2.2 Nicht-zufälliges Auswahlverfahren 82 2.3 Randomisierung 83 3. Macht es einen Unterschied, ob man randomisiert oder nicht? 83 Kapitel 13: Wie führt man die Randomisierung durch? 85 1. Einfache Randomisierung 85 2. Blockweise Randomisierung 86 3. Stratifizierte Randomisierung 87 4. Minimisation 87 5. Cluster Randomisierung 88 VIll Inhaltsverzeichnis 5.1 Individuelle Randomisierung nicht möglich 88 5.2 Effekt auf ganze Gruppe untersuchen 88 Kapitel 14: Wie analysiert und präsentiert man randomisierte, kontrollierte Studien? 89 1. Vergleich der Basisdaten 89 2. Vergleich der Endpunkte 90 3. Was man nicht machen sollte 93 Kapitel 15: Protokollverletzungen 95 1. Es läuft nicht immer alles so, wie wir wollen 95 2. Wie geht man am besten mit Protokollverletzungen um? 96 2.1 Patienten werden eingeschlossen, obwohl sie nicht eingeschlossen werden sollten 96 2.2 Patienten erhalten nach Randomisierung die "falsche" Intervention 97 2.3 Es fehlen Messwerte von primären (und anderen) Endpunkten 98 2.3.1 Was macht man nun wirklich? 98 3. Wie vermeidet man Protokollverletzungen? 100 Kapitel 16: Nicht ohne CONSORTI 101 Kapitel 17: Was unterscheidet den herkömmlichen Übersichtsartikel vom systematischen Übersichtsartikel? 105 1. Wozu braucht man systematische Übersichtsartikel? 105 2. Wo Suchen? 108 3. Systematisches Suchen 109 4. Suchbegriffe und ihre Verwendung 109 5. Beurteilung der Qualität von Studien 110 6. Beschreibung der eingeschlossenen Studien 111 7. Verfassen des systematischen Übersichtsartikels 112 8. Was ist eine Meta-Analyse? 113 9. Noch ein paar Worte zur Cochrane Collaboration 113 10. Weiterführende Literatur 114 KapitellS: Was ist eine Meta-Analyse? 115 1. Was ist eine Meta-Analyse? 115 2. Probleme der Meta-Analyse 118 2.1 Individuelle Studien von schlechter Qualität 119 2.2 Publication und Language Bias 119 2.3 Heterogenität 120 2.3.1 Klinische Heterogenität 120 2.3.2 Statistische Heterogenität 121 3. Wie macht man eine "Meta-Analyse"? 121 3.1 Die geeignete Methode zur quantitativen Synthese 121 3.2 Wie findet man Publication Bias? 122 3.3 Gibt es andere Störfaktoren, die das Ergebnis beeinflussen können? 123 3.4 Die Präsentation von Meta-Analysen 123 4. Meta-Analysen mit individuellen Patientendaten 124 5. Weiterführende Literatur 124 Kapitel 19: Wie viele Patienten braucht man für eine Studie? 125 1. Der Kontext 125 2. Wie berechnet man die Stichprobengröße? 126 Inhaltsverzeichnis IX 2.1 Allgemeines 126 2.1.1 Die Power 126 2.1.2 Die Größe des Effekts in der nicht exponierten Gruppe 126 2.1.3 Die Größe des Effektes in der exponierten Gruppe 127 2.1.4 Der Grenzwert des Typ I Fehlers 127 2.1.5 Wie viele Patienten werden verloren gehen 127 2.1.6 Sind Zwischenanalysen geplant? 127 3. Die wichtigsten Formeln zur Berechnung der Stichprobengröße 128 4. Wie hängen Power, Typ I Fehler, Stichprobengröße und Effektgröße zusammen? 129 5. Was ist eine Sensitivitätsanalyse? 131 6. Aus der Praxis 131 6.1 Power Analyse mit Korrelationskoeffizient als Effektgröße 131 6.2 Power Analyse mit Differenz kontinuierlicher Werte als Effektgröße 132 7. Computerprogramme zur Fallzahlberechnung 132 8. Fallzahlberechnung nach der Fertigstellung einer Studie? 132 9. Weiterführende Literatur 133 Kapitel 20: Data Management 135 1. Das Datenformular (Case Record Form) 135 2. Die Datenbank 136 3. Die Suche nach Eingabefehlem 136 4. Wie geht man mit fehlerhaften Daten um? 137 5. Datenschutz 137 6. Weiterführende Literatur 138 Kapitel 21: Stichproben und der Zufall 139 1. Wozu Stichproben? 139 2. Wie erhebt man Zufallsstichproben? 139 3. Wie erhebt man systematische Stichproben? 141 4. Komplexe Methoden zur Stichprobenerhebung 141 5. Wann sind Stichproben in der klinischen Forschung notwendig? 142 6. Weiterführende Literatur 142 Abschnitt 11 - Grundlagen der Analyse 143 Kapitel 22: Wie soll ich meine Daten präsentieren? 145 1. Hintergrund 145 2. Beschreibende Statistik 146 2.1 Beschreibende Statistik von kontinuierlichen Variablen 146 2.1.1 Median v Mittelwert 146 2.2 Beschreibung der Variabilität von kontinuierlichen Variablen 148 2.2.1 Die Standardabweichung 149 2.2.2 Perzentilen und Quartilen 150 2.3 Beschreibende Statistik von binären und kategorischen Variablen 151 3. Aus Beobachtungen Schlüsse ziehen 151 4. Pseudogenauigkeit: Wie viele Dezimalen sind sinnvoll? 152 Kapitel 23: Alles über den poWert - Der statistische Gruppenvergleich 155 1. Nullhypothese und Alternativhypothese 156 2. Die Power 158 3. Vertrauensbereiche 158 4. Statistische Inferenz 159 x Inhal tsverzeichnis Kapitel 24: Welcher statistische Test ist der Richtige? 161 1. Die wichtigsten Tests 161 1.1 Der ungepaarte t-Test 161 1.2 Der gepaarte t-Test 162 1.3 Wilcoxon Rank Sum Test, Mann-Whitney U-Test und Wilcoxon Signed Rank Test 163 1.4 Chi Square, Fisher's Exact und McNemar 165 2. Andere Tests 166 2.1 ANOVA und Kruskal-Wallis Test 166 2.2 Repeated Measurement ANOVA und Friedman-ANOVA 167 2.3 Unterschiedliche Beobachtungszeiten 167 2.4 Multivariate Methoden 167 Kapitel 25: Korrelation und Regression ist nicht das Gleiche 169 1. Korrelation 169 1.1 Allgemeines zur Korrelation 169 1.2 Ein paar Regeln zur Korrelation 171 1.3 In der Praxis bedeutet das ... 172 1.4 Wann ist ein Korrelationskoeffizient relevant? 173 1.5 Wie präsentiert man Korrelationen? 173 1.6 Zusammenhang ist kein Beweis für Kausalität! 174 2. Was ist Regression? 174 2.1 Allgemeines zur Regression 174 2.2 Einige Regeln zur Regression 175 3. Wann verwendet man Korrelation, wann Regression 176 Kapitel 26: Wie sollte eine wissenschaftliche Arbeit aussehen? 177 1. Allgemeines 177 1.1 Uniform requirements 177 1.2 Die Leiden der non-native Speaker 178 2. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit 178 2.1 Der Titel 178 2.2 Das Abstrakt 179 2.3 Die Methoden 179 2.4 Die Ergebnisse 179 2.5 Die Diskussion 179 2.6 Tabellen und Grafiken 180 2.7 Literaturangaben 180 2.8 Spezielle Situationen 180 Kapitel 27: Über Editoren und den Peer Review 183 1. Wozu Wissenschaft? 183 2. Wie mag's der Editor? 183 2.1 Der Editor als Repräsentant des Journals und der Leserschaft 184 2.2 Warum werden Arbeiten abgelehnt? 184 3. Wie finde ich das "richtige" Journal? 186 4. Der Peer Review Prozess 186 4.1 Wie läuft der Peer Review Prozess ab? 187 4.2 Probleme des Peer Review Prozesses 187 4.3 Auf welche Punkte sollte ein Gutachter eingehen? 188 4.4 Gibt es den idealen Gutachter? 188
Description: