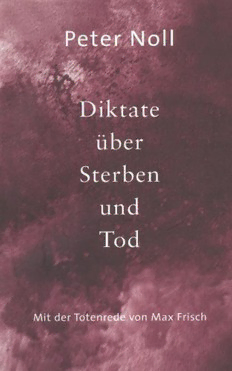
Diktate über Sterben und Tod PDF
Preview Diktate über Sterben und Tod
Peter Noll Diktate über Sterben und Tod Mit der Totenrede von Max Frisch Peter Noll DIKTATE ÜBER STERBEN UND TOD Mit der Totenrede von Max Frisch Pendo München und Zürich INHALT DIKTATE von Peter Noll vom 28. Dezember 1981 bis zum 30. September 1982 7 — 274 DIE LETZTEN TAGE bis zum 9. Oktober 1982 nach Erinnerungen von Rebekka Noll und Max Frisch 275 — 278 TOTENREDE von Max Frisch am 18. Oktober 1982 im Grossmünster in Zürich 279 — 284 JERICHO Drama (1968) 287 — 351 Schriftenverzeichnis Peter Noll von Louise Naef-Greber und Giatgen-Peder Fontana 353 — 358 Heute ist der 28. Dezember 1981, ich sitze in meiner Wohnung in Laax, habe den Blick auf das zuge- schneite Seelein und den Wald dahinter, von den Tan- nen fällt der Schnee, es ist ziemlich warm, wahr- scheinlich föhnig, die Sonne scheint nur als heller Fleck durch die Wolkendecke. Meine Wahrnehmungen über das zu protokollierende Ereignis haben am 17. Dezember begonnen. Die leichten Schmerzen in der linken Niere hatten sich in den vorangegangenen Tagen etwas verstärkt, so dass Christoph mir riet, eine Röntgenaufnahme mit Pyelo- gramm machen zu lassen, da wir beide vermuteten, es handle sich um einen Nierenstein, wie er in der rech- ten Niere — schmerzlos — seit langem festsitzt. Die zusätzliche Symptomatik eines häufigeren Wasserlö- sens fiel mir erst hinterher auf, und ich hätte sie auch nicht ernst genommen. Das Röntgeninstitut von Dr. X. ist eine gänzlich nor- male Einrichtung. Ich werde in einem der wahr- scheinlich mehreren Röntgenzimmer auf den Schra- gen gelegt und im Abstand von 10-20 Minuten ge- knipst, in der zweiten Hälfte der Zeit von etwa zwei Stunden mit dem Kontrastmittel. Für die Injektion kam der Chef (etwas verspätet, weil er noch an einem Spital mit einem biblischen Namen, den ich inzwi- schen vergessen habe, zu tun hatte), und am Schluss kam er auch wieder, verabschiedete sich ganz kurz, sagte etwas von einem Stein, den man zwar nicht recht sehe, der aber den Abfluss des Urins in der linken Niere behindere. Ein Röntgeninstitut ist ein rein tech- nischer Betrieb; der Chef hat nur mit der Interpreta- tion der Bilder zu tun, nicht mit den Patienten. Ko- misch fand ich, dass mein Röntgenzimmer zugleich Umkleideraum war für die Assistentinnen, die zum Teil einen erstaunlich späten Arbeitsbeginn hatten. 7 Am 19. (Samstag) kam dann das Telefon von Chri- stoph: Tumor. Nach dem Röntgenbild ist die Blase nicht mehr schön rund, sondern hat die Form eines stark abneh- menden Mondes. Christoph ist sehr beunruhigt; er organisiert alles weitere mit seinem Zürcher Kolle- gen, und so gelange ich am 22. Dezember (Dienstag) um 10.00 Uhr in die sehr gediegene Praxis des Urolo- gen. An den Wänden im Flur hängen Stiche von be- rühmten Rennpferden; sie sehen alle gleich aus, es gelingt mir nicht, charakteristische Unterschiede zwischen den verschiedenen Tieren festzustellen. Die Zystoskopie ist eine ekelhafte Prozedur, trotz Lokalanästhesie; nicht sonderlich schmerzhaft, aber von einer schlechten Schmerzqualität, mit Stechen, Jucken, Brennen, sinnlosem Harndrang. Etwas spä- ter im Sprechzimmer wird der Urologe sehr ernst, bei routinierter Gefasstheit, er kennt diese Fälle. In der Blase sehe man ein kleines, grobgewebiges (was auf Bösartigkeit hindeutet) Geschwür, welches den Harnleiter fast zudecke und dafür verantwortlich sei, dass die linke Niere nur wenig und langsam arbeitet. Man muss unbedingt jetzt genauere Untersuchungen anstellen: unter Narkose Gewebeproben entneh- men, um festzustellen, wie bösartig die Geschwulst sei, und dann komme das Computertomogramm. Auf jeden Fall müsse operiert werden. Es gebe eine leichtere und eine schwierigere Variante: wenn das Geschwür nur auf der Haut der Blase aufsitzt, kann ich mir einen Teil der Blase wegschneiden lassen und nachher mit einer etwas kleineren Blase gleich wei- terleben wie bisher; wenn das Geschwür die Blasen- wand durchwachsen hat, muss die ganze Blase ent- fernt werden, und ich bekomme einen künstlichen Ausgang, der ausserhalb des Körpers in einen Pla- stikbeutel führt, den man auf sich trägt und von Zeit 8 zu Zeit leert. Beide Nieren würden dann wieder ar- beiten, und die Überlebenschancen seien bei Blasen- krebs verhältnismässig gut, vor allem wenn man den Eingriff mit Bestrahlung kombiniere. Wie hoch die Chancen sind, lässt sich nur nach der Statistik fest- stellen — etwa 50 %. Auf meine Fragen: Geschlechts- verkehr sei nicht mehr möglich, da es keine Erektion mehr gibt, doch sonst keine wesentliche Beeinträch- tigung; Wandern, Sport in mässigem Umfang, sogar Ski fahren, die Patienten, die die kritischen fünf Jahre überlebt haben, haben sich alle an das beschnittene Leben gewöhnt. Da ich erkläre, dass ich einer sol- chen Operation unter keinen Umständen zustimmen würde, sagt er, er habe grossen Respekt vor einer sol- chen Entscheidung, aber ich solle mich doch vorher möglichst vollständig informieren, auch bei anderen Ärzten. Ob ich die Röntgenbilder mitnehmen wolle? Nein, der Fall scheint mir ziemlich klar. Ich stosse wieder auf eine von meinen Eigenschaften, die mir eigentlich längst vertraut sein sollte. Obwohl eher Zweifler und Zögerer von Natur aus, neige ich zu brüsken, schnellen und radikalen Entschlüssen in Krisensituationen, die mich selber betreffen. Die Respektbezeugung scheint gewissermassen eine Standardaussage zu sein; denn ich habe sie später noch einige Male gehört. Natürlich gehört es sich auch, einem solchen Patienten, der die Metastase wählt statt der apparativen Hinauszögerung des To- des, eine gewisse Ehrfurcht entgegenzubringen, ob- wohl er diese genau besehen gar nicht verdient; denn er hat ja nur die Wahl zwischen zwei Übeln, und es ist fast nur eine Frage des Geschmackes, welches Übel er vorzieht. 9 Das Gespräch zwischen einem, der weiss, dass seine Zeit bald abläuft, und einem, der noch eine unbe- stimmte Zeit vor sich hat, ist sehr schwierig. Das Ge- spräch bricht nicht erst mit dem Tod ab, sondern schon vorher. Es fehlt ein sonst stillschweigend vor- ausgesetztes Grundelement der Gemeinsamkeit. Nach dem üblichen Ritual des Sterbens müssen beide, der Sterbende und der Weiterlebende, sich an bestimmte Regeln halten; doch sind die Regeln, an- ders als beim Fussball, für beide Teile ganz verschie- den, so dass eben kein «Zusammenspiel» entsteht. Auf beiden Seiten wird viel Heuchelei verlangt. Darum auch die gequälten Gespräche an den Spital- betten. Der Weiterlebende ist froh, wenn er wieder draussen ist, und der Sterbende versucht einzuschla- fen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überinterpre- tiere und dem ganzen einen zu tiefen Sinn gebe. Zum Beispiel ärgert es mich jetzt schon, wenn Bekannte, die ich informiert habe, so tun, als wäre gar nichts los, und beispielsweise Pläne entwerfen, für deren Verwirklichung es völlig gleichgültig ist, ob ich dabei bin oder nicht. Wem habe ich es mitgeteilt, wem nicht? Am Anfang ziemlich zufällig allen Freunden, mit denen ich in Kontakt kam. Dabei hat, wie ich schon gleich fühlte und jetzt klar sehe, eine Rolle gespielt, dass ich mich an meinen Entscheid nach aussen hin binden wollte, so wie einer, der aufhört zu rauchen: er sagt es seinen Bekannten, damit er sich blamiert, wenn er schwach wird. Später bin ich selektiv und überlegter vorge- gangen. Nach dem röntgenologischen Befund habe ich mit Martin Gschwind telefoniert. Zuerst reagierte er nach dem ärztlichen Schema, allerdings mit seinem 10
