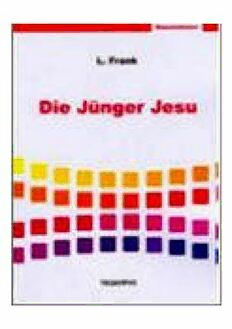
Die Jünger Jesu PDF
Preview Die Jünger Jesu
Hauslektüre L. Frank 9 Die Jünger Jesu Комментарии и задания М.П. ПИРОНКОВОЙ МОСКВА ТЕЗАУРУС 2008 УДК 803.0 ББК 81.2 Нем Ф 84 Франк Л. Уч. пос. по немецкому языку для развития Ф 84 Die Jünger Jesu.: навыков устной речи. /Комментарии и задания М.П. Пиронковой/. - М.: ТЕЗАУРУС, 2008. - 178 с. ISBN 978-5-98421-036-2 Роман известного немецкого писателя-гуманиста Леонгарда Франка „Die Jünger Jesu“ предлагается в неадаптированном виде для работы со студентами гуманитарных вузов на II-III курсах по аспекту «домашнее чтение». Текст романа разделён на 11 частей, каждая из которых снабжена комментарием, поясняющим реалии и языковые трудности, встречающиеся в данной части. Кроме того, автором пособия из текста выделяются слова для активного усвоения и даются задания для закрепления активного словаря и обсуждения тематики каждой части. Все права по тиражированию и реализации данной книги принадле жат издателю. УДК 803.0 ББК 81.2 Нем ISBN 978-5-98421-036-2 © Пиронкова М.П., комментарии и задания, 2008 © ТЕЗАУРУС, 2008 LEONHARD FRANK (1882- 1961) L.FRANK wurde am 4. September 1882 als Sohn eines Schreinergesellen in Würzburg am Main geboren. In seinem Roman „Links, wo das Herz ist“ (1952) beschrieb er seine Kindheit und sich selbst unter dem Namen Michael Vierkant. „Michael war das Sorgen vermehrende unerwünschte vierte Kind gewesen. Sein Vater, ein Schreinergeselle, der Parkettböden legte und glatthobelte - zehn Stunden am Tag auf den Knien nah am Boden, den er hobelte, hartes Buchen holz, - verdiente achtzehn Mark in der Woche. Am Esstisch gab es große Augen und kleine Bissen. Acht Monate im Jahr liefen die Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen, keine Schuhsohlen durch. Aber im Winter, wenn Schnee lag und der Main zugefroren war, konnten sie nicht mehr barfüßig in die Schule gehen.“ Nach der Schlosserlehre - in der er nach dem Absolvieren der Volksschule war - versuchte er sich in verschiedenen Berufen. Einige Jahre studierte er in München die Malerei. Mit 25 war er Stammgast im Münchener Boheme-Cafie „Stephanie“. Er wollte sich* zunächst als Grafiker beweisen. Als 28-jähriger begann er in Berlin Prosa zu schreiben. Sein Erstlingswerk „Die Räuberbande“ wurde 1914 mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet. L.Frank vertrat die Meinung, dass vor dem Schriftsteller nicht nur ästheti sche, sondern vor allem ethische Aufgaben stehen. Er kannte und schätzte die einfachen Menschen, deren Lebensweise er mit Liebe und Sachkenntnis in seinen Werken schilderte. Doch, aufgewachsen in den beschränktesten sozialen Verhältnissen, in materieller Not, liebte Frank extravagante Sportwagen, supermodische Anzüge. Das Paradoxe haftete diesem aus einfachen Verhältnissen stammenden Autor an, als sei er ein verwandelter Prinz, der in immer neuen Gewändern eine immer gleiche Rolle spielt: die eines einfachen Autors, des ewigen Autodidakten. Im Ersten Weltkrieg musste L.Frank in die neutrale Schweiz emigrieren, wo er sich einer Gruppe der Pazifisten in Zürich anschloss. Er war einer der ersten ans im 20. Jahrhundert, die Protest gegen den Krieg ins Exil gingen. In der Schweiz schrieb er sein Antikriegswerk „Der Mensch ist gut“. Die fünf Erzählungen des Buches sind Manifeste gegen den sinnlosen Tod, eine Anklage gegen das Massenmorden der europäischen Kriegsmaschinerien. 1918 kehrte er aus der Schweiz zurück, lebte in Berlin und zeitweise in München. 1920 erhielt er für sein Werk „Der Mensch ist gut“ den Kleist-Preis. Er verlor seine Frau, die herzkrank war, und versuchte sich durch Arbeit hinwegzuhelfen. In dieser Zeit entstanden einige seiner wichtigen Prosawerke: der Roman „Das Ochsenfiirter Männerquartett“, die Liebesnovelle „Karl und Anna“ sowie die Romane „Der Bürger“ und „Von drei Millionen drei“. 1925 entstand das Prosastück „Im letzten Wagen“. 1928 wurde L.Frank in die Preußische Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst gewählt. 3 Als 1933 der Hitlerfaschismus in Deutschland zur Macht kam, musste L.Frank nicht wegen der Rasse, sondern wegen seiner Gesinnung wieder die Heimat verlassen. Seine Werke wurden von Faschisten verboten. In Frankreich und in den USA erlitt er Demütigungen der Emigration: das Internierungslager in Frankreich, die Flucht über die Pyrenäen, Lohnarbeit in den Drehbuch-Büros in Hollywood. Dieses zweite Exil wurde ihm unendlich härter als manch anderem Emigranten. Er war Autodidakt. Er gehörte nicht dem intellektuellen Literaturbetrieb an, der einem Autor Nebeneinnahmen verschafft. Er war weder Kritiker noch in den schriftstellerischen Brotarbeiten erfahren und geübt - kein Herausgeber, kein Essayist - er war schlicht Erzähler, Dichter und demzufolge in besonderer Weise in der deutschen Sprache verwurzelt und von ihr abhängig. Aus dem Exil brachte er unter anderem die Romane „Traum- gefahrten“, „Mathilde“ und „Deutsche Novelle“. 1949 schrieb L.Frank „ Die Jünger Jesu“, die in Würzburg Proteste hervor riefen, denn dieser Roman hält Abrechnung mit den überlebenden Nazis, die es entweder nicht gewesen oder wieder sein wollten. In seiner Heimatstadt war er nicht beliebt. Man hielt ihn für einen „VaterlandsVerräter“ und „Drückeberger“, denn in einer Stadt, die sich durch eine fortgesetzte Intoleranz auszeichnete, die ein Zentrum der Judenverfolgung lange vor der nationalsozialistischen Unter drückung war, konnte ein Mann keinen Platz haben, der den Bürgern Wahrheit ins Gesicht sagte. Er war Pazifist und Sozialist nicht aus Ideologie, sondern aus der Überzeu gung, dass die Menschheit weiterleben und ihr dieses Weiterleben gefallen solle. Er hatte als Kind seelische Versehrungen erlitten, die ihn zum Schreiben zwan gen. Er durchschaute den Krieg als die grausamste und sinnloseste Massen schlächterei unter Wesen, die sich Menschen nennen und das einfachste Gebot nicht achten: Du sollst nicht töten. Er war gegen die Todesstrafe, für eine soziale Gerechtigkeit, für einen Staat ohne Unterdrückung: ein Menschenfreund, der die Liebe unter den Menschen proklamiert - nicht weil der Mensch gut ist, sondern weil er gut wird, wenn er liebt. Was er meinte, was er wollte, worunter er litt, steht in seinen Romanen, Erzählungen, Kurzgeschichten und seiner romanti schen Autobiographie. Hans Berger schrieb in seinem Artikel „Gerechtigkeit für einen Gerech ten“, der 1982 anlässlich des 100-jährigen Geburtstags L.Franks veröffentlicht wurde: „Nach seinem Tod 1961 in München ... ließen ihm die Literaturmono- graphen, die Kritiker und auch die Leser - bis auf zu wenige Ausnahmen - nicht die Gerechtigkeit widerfahren, die er verdient hatte. Die Gerechtigkeit, anerkannt zu werden als Realist und Idealist, als Ankläger des Militarismus und Faschis mus, der sozialen Ungerechtigkeit. ... Auch von der Gegenwart verdient er mehr Bedeutung und Anerkennung.“ L.Frank Würzburg am Main, die Stadt des Weines und der Fische, der Kir chen, gotisch und barock, wo jedes zweite Haus ein unersetzliches Kunst denkmal war, wurde nach dreizehnhundertjährigem Bestehen in fünfund zwanzig Minuten durch Brandbomben zerstört. Den folgenden Morgen floss der Main, in dem sich die schönste Stadt des Landes gespiegelt hatte, langsam und gelassen durch Schutt und Asche, hinaus in die Zeit. Johanna ging den Fluss entlang. Hinter ihr waren nur noch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, vor ihr stand das junge Grün der Weidenbüsche in der Sonne, schimmernd und im Safte strotzend, als wäre nichts geschehen. Die Landschaft war nicht zerstört. Über dem ganzen Tal schien ein Seidenteppich zu liegen - grün in grün geknüpfte Rebhügel, Wald und Obstbaumfelder und das bogenreiche blaue Band, an dessen Ufer Würzburg gewesen war, das jetzt eine zerhackte Ruine ist, ein Denkmal der Naziherrschaft. Johannas Mutter war schon lange tot. Ihr Vater, der Zeichenlehrer am städtischen Gymnasium und ein Nazi gewesen war, hatte sich aus Angst vor der unaufhaltsam vorrückenden amerikanischen Armee am Fensterkreuz des Zeichensaales rechtzeitig aufgehängt und einen Brief hinterlassen, in dem er seine unpatriotische Tochter zum letzten Mal verfluchte. Johanna war einundzwanzig und allein. Sie hatte braunes Haar, hellbraune Augen, von leuchtenden Stern chen besetzt um die Pupillen herum, und ein schmales weißes Gesicht, das auch in der brennenden Julisonne weiß blieb. Der Mund war wie von Albrecht Dürer genau und einfach gezeichnet. Sie sah aus, als wäre sie von der Natur dazu bestimmt, den nach Jahrmillionen und zahllosen Experimenten schließlich erreichten Grad körperlicher Anmut weiterzu geben an kommende Generationen. Das letzte Jahr, seit dem Ende des Krieges, war sie wie alle armen Leute von früh bis abends damit beschäftigt gewesen, das nötige Stück Brot zu bekommen. Geld hatte sie nicht, und Arbeit für eine Sekretärin 5 gab es nicht - es gab keine Schreibmaschinen mehr in einer Stadt, die es nicht mehr gab, und die amerikanische Militärbehörde hatte es abge lehnt, eine Sekretärin zu beschäftigen, deren Vater ein Nazi gewesen war. Sie hätte den Verfluchungsbrief des Vaters vorlegen können. Alles würde dann vielleicht ein bisschen leichter gewesen sein. Sie hatte es unterlassen, aus Takt und Eigensinn des Herzens. So war sie. Johanna hatte einen zerfallenen, seit Jahren unbenutzten Ziegenstall, drei Meter im Quadrat, der zwischen Weidenbüschen am Flussufer stand, gründlich gereinigt und mit den Resten ihrer Habe notdürftig eingerichtet. Sie setzte sich ein paar Meter vom Stall entfernt ans Flussufer und blickte über das Wasser hinweg in die Feme, empor zum Tannenwald, über dem, im tiefen Blau, eine rosa Wolke schwamm. Die sinkende Sonne war schon rot. Schon erklangen die Stimmen der Tiere vereinzelt in der Abendstille. Das Wasser roch stärker. Bewegungslos schwebte ein felsgrauer Fisch reiher hoch über dem Fluss, jede Sekunde bereit, herabzustoßen. Es war sechs Uhr, die Stunde, da der Fisch an die Oberfläche steigt. Johanna, die keine Gegenwart und keine Zukunft hatte, war in der Vergangenheit versunken. Bilder aus der Kindheit, innig verwoben mit den Gassen der Heimatstadt, kleine Freuden im milden Sommerabend, die kleinen Kümmernisse, die ihr groß erschienen waren, kehrten wieder, klar, wie soeben erst erlebt. Im Mundbezirk entstand der Anflug eines Lächelns. Der Mund, der das Lachen verlernt hatte, blieb genau ge schlossen. Sie stellte den Kopf schief und lauschte. Sie vernahm das Sechsuhr läuten der dreißig Kirchenglocken von Würzburg, das sie von Kindheit an gehört hatte, und es war ihr ein paar Sekunden nicht bewusst, dass sie Glocken läuten hörte von Kirchen, die nicht mehr standen. Sie atmete tief aus und stieg, während Sie aufstand, aus der Kindheit wieder herauf in die Stunde der Gegenwart. Sie blickte zurück, dorthin, wo Würzburg gewesen war. Sie sah das graue Trümmerfeld. Ihr Kopf sank langsam, und sie dachte: ,Wie soll man sich denn loslösen können von der Stadt, in der man aufgewachsen ist. Sie ist ja in uns. Wir sind ja ein Teil von ihr’ Sie schob die Lippen vor gegen das Leben. ,Jetzt sind nur noch wir Würzburg. Nur noch wir.’ Sie ließ sich wieder nieder ins Gras und saß reglos, den Kopf in beiden Handschalen, die Ellbogen auf den Knien. Sie sah nichts und dachte an nichts. So sitzt irgendwo auf der Welt der Heimatlose, für den es aus tausend und einem Grund keinen Halt und keinen Weg mehr gibt. 6 Die Witwe Hohner wohnte im Keller des zerstörten Hauses, in dem sie fünfzig Jahre ein dunkles Parterrezimmer bewohnt hatte. Mit der gebogenen Nase und dem nach vorne geschweiften spitzen Kinn, an dem zwei Warzen waren, sah die zahnlose Alte aus wie die Hexe im Märchenbuch. Sie war eine der Ärmsten dieses Armenviertels, das jetzt in Trümmern lag. Sie hatte fast nur von Brot und Kaffee gelebt. Die Kaffeekanne hatte den ganzen Tag auf der warmen Herdplatte gestanden. Kaffee war der Trost ihres Lebens gewesen. Aber Kaffee gab es schon lange nicht mehr. Eines Morgens - sie hatte das Kopftuch umgebunden und wollte schon durch die Tür, um in die Kirche zu gehen - bemerkte sie in der Däm merung, dass neben der Tür auf dem gestampften Kellerboden eine Tüte lag. Sie spürte sofort, was in der Tüte war. Frau Hohner glaubte an Gottes Allmacht. Aber sie wagte nicht zu glauben, was sie spürte, bis sie die dunkelbraunen, fettglänzeaden Bohnen sah und mit den gichtigen Fin gern hineingegriffen hatte. Obenauf lag ein Zettel, auf dem etwas geschrieben war, in Kinder schrift. Sie setzte die stahlgefasste rostige Brille auf und las laut: „Die Jünger Jesu.“ Sie bemerkte nicht, dass der Uhrmacher Krummbach eintrat, der im hintern Teil des Kellers wohnte. Seine Füße steckten in Sackleinwand, an die er Sohlen aus Pappdeckel genäht hatte. Er trug ein Paar gebrauchte Schuhe in der Hand und in der anderen einen Zettel. Der Uhrmacher, ein großer, aufgeschwemmter Mann, war siebenundsiebzig und schon fast blind. Er bat Frau Hohner, sie solle ihm vorlesen, was auf dem Zettel stehe. „Die Schuh mit dem Zettel“, sagte er verwundert, „standen heut früh vor meinem Bett.“ Sie las: „Die Jünger Jesu.“ Sie konnte vor Erregung nicht aufstehen. Kniend erzählte sie, was ihr geschehen war. Der Uhrmacher half ihr auf die Beine. Sie fragten einander, wer auf der Welt die Schuh und den Kaffee gebracht haben könnte. Niemand in Würzburg besitze diese kost baren Sachen. Der Herr Magistratssekretär Hömle gehe jeden Tag [ ц seinen alten Pantoffeln ins Büro, und Kaffee habe nicht einmal der Bürgermeister. Nach langem Hin und Her, das zu keiner Aufklärung führte, flüsterte Frau Hohner: „Vielleicht haben wirklich die Jünger Jesu den Kaffee und die Schuh geschickt, weil wir so in Not dafür sind.“ Der Uhrmacher schüttelte ungläubig den Kopf. „In früheren Zeiten hat's Wunder gegeben, das wissen wir. Aber heutzutag gibt's kein e Wunder mehr.“ Er zog die Schuhe gleich an. Während er sich besser 7 hineintrat, sagte er: „Die Schuh halten, solang ich lebe, und passen tun sie mir wie angemessen.“ Auf dem Weg zur Messe in der Klosterkirche, erzählte er, den Abend vorher, habe ein Junge ihn auf der Straße nach seiner Schuhgröße ge fragt. „42, sagte ich. Der Lausbub verschwand so plötzlich, wie er erschienen war.“ „Es kann ein Sendbote der Jünger Jesu gewesen sein“, sagte Frau Hohner und schlug erschauernd das Kreuz. Da schlug schließlich auch der Uhrmacher das Kreuz. Und da sie soeben vor der Kirche angelangt waren, verstand es sich fiir die anderen Gläubigen von selbst, dass die Bekreuzigung dem Jesusbildwerke gegolten hatte, das über dem Portale hing. Der Glöckner der Klosterkirche konnte die Messe nicht mehr ein läuten wie in vergangenen Zeiten. Eine Bombe hatte den Turm wegge rissen. Seitdem war die Kirche stumm. Sie gingen hinein. Als sie eine Stunde später vor dem dampfenden Kaffee saßen, tief unter dem vergitterten Kellerfenster, und den ersten Schluck versucht hatten, sagte der Uhrmacher: „Ich hab ein Paar Schuh an, und hier sitzen wir und trinken Kaffee. Aber zu verstehen ist es nicht.“ Frau Hohner sagte nichts. Sie schlug das Kreuz und dachte, während sie es tat: ,Ein kleines bisschen zu dunkel gebrannt sind die Bohnen. Man schmeckt’s.’ Gegen sechs Uhr abends schlüpfte der zwölfjährige Sohn des Kir chendieners, der den Uhrmacher Krummbach nach dessen Schuhgröße gefragt hatte, vorsichtig in den kleinen Friedhof hinter der Klosterkirche. Der Mönchsfriedhof, von der Außenwelt abgeschlossen durch eine hohe Mauer, die vollständig von Efeu bedeckt war, wurde seit hundert Jahren nicht mehr benutzt. Nur noch ein paar uralte Sandsteinplatten, brüchig und moosbewachsen, lehnten schief an der Efeuwand. Wetter und Zeit hatten die Inschriften verwischt. Meterlange dicke Grasbärte, von der Sonne gebleicht, polsterten die vergessenen Gräber. Hierher kam in Jahren kein Mensch. Der Sohn des Kirchendieners schloss eine niedrige Tür auf, mit einem zwei Pfund schweren Schlüssel, den er wie ein Schwert seitwärts an seinem Gürtel trug. Ein paar Fledermäuse huschten an ihm vorbei ins Freie, während er die dreißig ausgetretenen Steinstufen hinabstieg in den Keller der Klosterkirche. Die dicke Finsternis roch nach Mauer, Staub und Moder. Er zündete zwei Kerzen an, die er in der Wachskammer seines Vaters heimlich mitgenommen hatte. Mit dem Erstarken der Flamme wurden zwei Rega le sichtbar, verhangen mit Betttüchern, und allerlei Gerümpel, darunter 8 zerbrochene Betstühle, ein zentnerschwerer Tisch, der nur noch drei Beine hatte und vom Holzwurm zerfressen war, und Glieder und Köpfe von uralten Heiligenbildwerken. In der Ecke lehnte ein riesiger Christus aus Lindenholz. Die weiße Farbe war teilweise abgeblättert. Ein Arm, ein Bein und der Kopf fehlten und auch das Kreuz. Die Gebärde des Körpers - eine geschwungene Schmerzenslinie - offenbarte, wie er einstens am Kreuze gehangen hatte. Ein Junge erschien in der Türöffnung. Er breitete schweigend beide Arme aus, schief nach oben wie der Gekreuzigte, und setzte sich vor sichtig in einen der wackeligen Betstühle. Kurz danach kamen zwei. Sie legten eine Wolldecke und eine alte Hose auf den dreibeinigen Tisch, breiteten schweigend die Arme aus und setzten sich. Punkt sechs Uhr saßen elf in Lumpen gekleidete Knaben in den Betstühlen im Halbkreis um den verstümmelten Christus herum, auf den das Licht der Kerzen- flammen fiel. Die Jünger Jesu waren versammelt. Der älteste, der Sohn eines Gastwirtes, war vierzehn, der jüngste zwölf. Es waren nur elf Jünger. Der Sohn des Untersuchungsrichters hatte sich geweigert, Judas Ischariot zu sein. Und da weder Petrus noch Johannes noch Bartholomäus und die anderen Jünger ihren Ehrennamen abgegeben hatten für den des biblischen Verräters, war der Sohn des Untersuchungsrichters während der Gründungsversammlung verbittert ausgeschieden. Er wolle nicht der Verräter sein. Er sei kein Verräter. Von außen drang kein Laut in den tiefen Keller. Die schwach beleuchteten Knabengesichter hingen wie kleine verschleierte Monde in der Dunkelheit. Während der Minute, da die vorgeschriebene vollstän dige Stille herrschte, hatten die Jünger Jesu den Ausdruck spielender Kinder, die ihr Spiel ernst nehmen. Schließlich ertönte die feierliche Stimme Petrus , des Vierzehnjährigen. „Wir, die Jünger Jesu, Voll 1 strecker der Gerechtigkeit, nehmen von den Reichen, die alles haben, und geben es den Armen, die nichts haben.“ Petrus hatte einen wuchtig ausladenden Schädel, ein sehr schmales, langes Gesicht und feurig blaue, kleine Augen. Er lehnte sich zurück und sagte geschäftsmäßig: „Die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte um den Bericht übe r die heutigen Neuerwerbungen und Auslieferungen.“ Der Jünger Johannes, ein weiches Bürschchen mit weißer Haut und dunkelbraunen Locken, streckte den Arm senkrecht empor und rief: „Eine schwarz und gelb getigerte Wolldecke vom Metzgermeister Stumpf! Ich hab’s euch ja gestern gesagt, dass er zwei hat, sich aber nur mit einer zudeckt. Auf der untern liegt er. So was! Hat er das nötig? Also, i ch hab ungefähr eine Stunde auf der Lauer gelegen, nämlich so lang, bis 9
