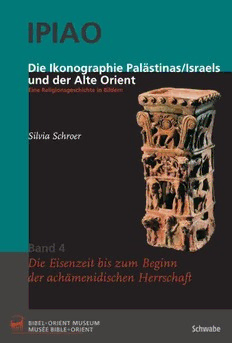Table Of ContentSilvia Schroer
Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient
Band 4
IPIAO
Die Ikonographie Palästinas/Israels
und der Alte Orient
Eine Religionsgeschichte in Bildern
In vier Bänden
Silvia Schroer
Die Ikonographie Palästinas/Israels
und der Alte Orient
Eine Religionsgeschichte in Bildern
Band 4
Die Eisenzeit bis zum Beginn der achämenidischen Herrschaft
Unter Mitarbeit von
Barbara Hufft
Philipp Frei
Florian Lippke
Patrick Wyssmann
Schwabe Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.
Titelbild = No 1197 mit freundlicher Erlaubnis des Israel Museum, Jerusalem
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Satz/Layout: Julia und Alexander Müller-Clemm, Döttingen
Grafik: Benny Mosimann, Atelier für Gestaltung, Bern
Druck: Hubert & Co., Göttingen
Printed in Germany
ISBN Printausgabe 978-3-7965-3878-0
ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-3879-7
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche.
Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch
www.schwabeverlag.ch
Inhalt
7 Vorwort
Die Eisenzeit bis zum Beginn der achämenidischen Herrschaft (1250/1150-500a)
11 I. Datierung
11 II. Hauptorte
15 III.A Kulturgeschichtliche Erträge des archäologischen Befunds
1. Archäologische Spuren der politischen Geschichte Israels und Judas
2. Gräber und Bauwerke
3. Ikonographie und biblische Texte als Quellen zur Rekonstruktion der
Religionsgeschichte
25 III.B Kulturgeschichtliche Horizonte
1. Ägypten (verfasst von Barbara Hufft)
1.1 Das Ende des Neuen Reiches und die Dritte Zwischenzeit
1.2 Kuschiten- und Saitenzeit: Ägypten im überregionalen Machtkampf
1.3 Die letzten Dynastien: Ägypten und die Perser
1.4 Ägypten: Einige Bemerkungen zu Entwicklungen von Kunst und Kultur in der
1. Hälfte des 1. Jt.a
2. Der Vordere Orient und die Levante: Wandel und Neubeginn (verfasst von
Philipp Frei)
2.1 Die Philister in ihrer neuen Heimat
2.2 Die späthethitischen Kleinkönigreiche Anatoliens und Nordsyriens
2.3 Das neuassyrische Großreich
2.4 Urartu – Königreich der Berge
2.5 Die phönizischen Stadtstaaten und ihr Fernhandel
2.6 Zypern – Schmelztiegel der Kulturen
2.7 Griechenland und der Orient
2.8 Ammon, Moab und Edom
2.9 Die altsüdarabischen Reiche
2.10 Babylonien
2.11 Auf dem Weg zur Großmacht: das frühe Achämenidenreich
60 IV.A Themen der Bildkunst der Eisenzeit I-IIA (1250/1200-840a)
1. Unter ägyptischen Herrschern und Göttern: Nachhall der Spätbronzezeit und
neue Akzente
1.1 Schlange, Löwe und Sphinx als königliche Bezwinger und Wächter
1.2 Der Bogenschütze als königlicher Jäger und Krieger
1.3 Das Niederschlagen der Feinde
1.4 Die Verehrung des Königs
1.5 Amun und Amun-Re
1.6 Re-Harachte, Horus und Seth
1.7-1.8 Maat, Thot, Ptah, Sachmet und Bastet
1.9 Anat und Astarte in ägyptischer Couleur
1.10 Bes und Patäke
1.11 Hathor und die schönen Dinge
1.12 Osiris, Isis und Horus
1.13-1.15 Neues Leben
2. Autochthone Traditionen
2.1 Die nackte Göttin
2.2 Mutter und Kind
2.3 Frauen mit Handtrommel
2.4 Frauen an Tempelmodellen und Tonständern
2.5-2.6 Göttin, Schlange, Taube und Granatapfel
2.7-2.8 Mykenisches Erbe – Göttinnen, Klagefrauen, MusikantInnen
2.9 Capriden und Skorpione
2.10 Zweige und Baumkult
2.11 Der Herr der Tiere
2.12 Reschef und Baal-Seth
3. Autochthone Traditionen vor nordsyrisch-anatolischem Horizont
3.1-3.2 Der Stier, der nordsyrisch-anatolische Wettergott und seine Partnerin
3.3 Löwenbezwinger und der Löwe als Bezwinger
3.4-3.5 Kämpfende, kriegerische und thronende Götter und Männer
3.6 Astralverehrung, Wächter- und Mischwesen
72 IV.B Themen der Bildkunst der Eisenzeit IIB (840-700a)
1. Ägyptische Herrscher- und Sonnensymbolik
1.1 Das Image des ägyptischen Herrschers und Hofs
1.2 Königliche Löwen, Sphingen und Greifen in Wächterfunktion
1.3-1.6 Sonnengötter und Solarsymbolik
1.7-1.10 Ägyptische Gottheiten
2. Autochthone Motive im Umfeld levantinischer, syrischer und neuassyrischer
Traditionen
2.1 Esel, Schlange und Strauß
2.2 Die nackte Göttin
2.3-2.4 Säulenfigürchen und Frauen mit Handtrommel
2.5 Höfische Frauen und die Frau am Fenster
2.6-2.7 Die Löwen und Tauben der Göttin
2.8-2.10 Capriden, Zweige und Granatäpfel
2.11 Kuh und Kalb
2.12 Stier und Wettergott unter neuassyrischem Einfluss
2.13 Mondgott, Himmelsgötter und Ischtar
2.14-2.15 Löwen und Mischwesen als Gegner und Wächter
2.16 Stilisierte Bäume, Palmetten und Kapitelle
2.17-2.18 Masken, Thronende und Bankette
2.19 Unter assyrischer Herrschaft: Krieg, Dominanz und Herrscherkult
82 IV.C Themen der Bildkunst der Eisenzeit IIC bis zum Beginn der achämenidischen
Herrschaft (700-500a)
1. Das Aufleben ägyptischer Traditionen
1.1-1.2 Königssphingen und Wächterwesen
1.3 Herrscher und Horus
1.4-1.10 Die ägyptische Götterwelt
2. Das Weiterleben kanaanäischer Traditionen
2.1-2.3 Nackte Göttinnen und Frauenbilder
2.4 Baumkult und Capriden
2.5 Der Stier und die Wettergötter
3. Göttliche und weltliche Mächte unter assyrischen und aramäischen Vorzeichen
3.1-3.2 Die assyrische Götterwelt
3.3 Der Mondgott
3.4-3.5 Die dämonische Tierwelt und ihre Bezwinger
3.6 Krieg, Dominanz und Herrschaft
3.7 Entwicklungen der babylonischen und frühesten achämenidischen Zeit (6. Jh.a)
89 V. Biblische Bezüge – ausgewählte Schwerpunkte in Ergänzung zu IPIAO 3
1. Ägyptische Dominanz- und Triumphsymbolik
2. Der König als loyaler Sohn der Gottheiten
3. Ägyptens Götterwelt
4. Leben durch die Sonne
5. Liebe(sgöttin) und Tod
6. Das Weiterleben der erotischen Göttinnen
7. Die Attribute und Symbole der Göttin
8. Der Kult für die Göttin
9. Frauenkörper und Architektur
10. Kriegerische und astrale Göttinnen
11. Der Kult für die Nachtgestirne
12. Kämpfer und Krieger
13. Stier und Löwe
14. Wächter und Helfer
15. Thronende Herrscher, thronende Götter
16. Sonnengott und Pferde
17. Assyrische Herrschaftsideologie
116 Eisenzeit I-IIA: Katalognummern 994-1375
418 Eisenzeit IIB: Katalognummern 1376-1705
668 Eisenzeit IIC bis zum Beginn der achämenidischen Herrschaft: Katalognummern 1706-1974
871 Hinweise zur Benutzung und Abkürzungsverzeichnis
873 Literaturverzeichnis
926 Bildnachweis
930 Ortslagenregister
Gesamtregister IPIAO 1-4
940 Gesamtregister Motive (in Auswahl)
951 Gesamtregister Ortslagen
958 Gesamtregister Bibelstellen
Vorwort
Der 4. Band unserer IPIAO-Reihe hat den Dreijahrestakt der früheren Bände nicht
eingehalten. Die Fülle der hier präsentierten Objekte war zu groß – insgesamt nochmals
etwa gleich viele Katalogstücke wie in den ersten drei Bänden zusammen.
Die Epoche, die der vorliegende Band umspannt, umfasst etwa sechs Jahrhunderte,
vergleichbar der Zeitspanne von MB IIB- und SB-Zeit zusammen. Dass die E-Zeit
mit mehr Artefakten präsentiert wird, ist auf die heterogenen Entwicklungen ab dem
späteren 12. Jh.a zurückzuführen. Wir haben versucht, der üblichen Unterteilung in
E I-IIA, E IIB und E IIC (mit einem Ausblick in die frühachämenidische Zeit) in unserer
Darstellung der Ikonographie treu zu bleiben. Diese herkömmliche Unterteilung basiert
auf den Kenntnissen der größeren geschichtlichen Ereignisse und Entwicklungen, die
für Palästina/Israel von Bedeutung waren, und sie ist auch für die Archäologie und
die Zuweisung von Straten maßgeblich. Gerade beim Versuch, die Entwicklungen
der Bildkunst geordnet darzustellen, wird allerdings deutlich, dass die Datierungen
von Objekten in vielen Fällen der gewählten Feinrasterung nicht dienen können.
Viele Katalogstücke sind nicht auf hundert Jahre genau, manche nicht einmal auf
zweihundert Jahre genau datierbar. So wird eine größere Zahl zu Zweifelsfällen,
was ihre Zuordnung zu den genannten Unterabschnitten der E-Zeit betrifft. Auf die
übliche Epocheneinteilung zu verzichten und beispielsweise die E IIB- und E IIC-Zeit
als eine einzige Epoche zu behandeln, schien dennoch nicht angeraten. Denn die
Untersuchungen insbesondere von Othmar Keel und Christoph Uehlinger (52001)
haben gezeigt, dass die Feineinstellung sehr relevante – und inbesondere von der
Bibelwissenschaft gefragte – Ergebnisse für religionsgeschichtliche Entwicklungen in
relativ kurzen Zeitabschnitten erbringen kann.
Mit vielen Kompromissen im Einzelnen haben wir versucht, die ikonographische Evidenz
als Leitfaden sowie die Kontinuitäten im Blick zu behalten und Neuakzentuierungen
über den Verlauf der Epochen gut sichtbar zu machen. Traditionell ist auch der zeitliche
Schnitt am Ende, für den wir uns nicht zuletzt im Hinblick auf die Materialmenge
entscheiden mussten. Die babylonische Zeit ist ikonographisch schwer zu füllen, die
Perserzeit bringt hingegen neben den ägyptischen, phönizischen oder kanaanäischen
Themen ganz neue Schwerpunkte. Diese sind Gegenstand des Nachfolgeprojekts
BIPOW (Die Bildwelt Israels/Palästinas zwischen Ost und West), das die Perserzeit
und die hellenistische Zeit umfasst (www.bipow.unibe.ch).
Wie in den früheren Bänden haben wir die Objekte aus Palästina/Israel kontextualisiert,
um ihre Bedeutung sichtbar zu machen, d.h. mit Artefakten aus den umliegenden
Kulturen vergesellschaftet. Dies entspricht dem in Band 1 grundgelegten methodi-
schen Ansatz (IPIAO 1,23f). Das Prinzip der Selektion war und ist ein mehrschich-
tiges. Einerseits werden zeitgenössische Kontakte insbesondere nach Ägypten und
Nordsyrien-Anatolien, aber auch in die Ägäis oder nach Mesopotamien sichtbar
gemacht. Andererseits werden manchmal auch Themenkreise aufgenommen, die
ikonographisch in Palästina/Israel in der betreffenden Zeit keinen Nachhall gefunden
haben mögen, jedoch später bedeutsam wurden, sei es in der Ikonographie oder
im Gedankengut biblischer Texte. Darüber hinaus ist eine Korrelierung zwischen
Funden aus Palästina/Israel und den Nachbarregionen nur aufschlussreich, wenn
auch sichtbar wird, welche Themen nicht rezipiert wurden. Im Wissen darum, dass
7
der Gesamtkatalog in der Selektion der Stücke, der Anordnung der Themen und der
Zuordnung der Artefakte, thematisch wie chronologisch, nicht mehr als ein fundierter
Versuch sein kann, sind wir doch überzeugt, dass die vorliegende Materialsammlung
für die Forschungsgemeinschaft von Nutzen sein wird. Aus der Fülle der Daten, die hier
zusammengetragen wurden, muss weitere Forschung erwachsen, die voraussichtlich
manche der expliziten und impliziten Faktoren unseres Entwurfs in Frage stellen und
neue Vorschläge machen wird. IPIAO 4 bietet zwar, wie die vorhergehenden Bände,
geraffte Hintergrundinformationen zur Geschichte der zahlreichen Nachbarkulturen
und -imperien Palästinas/Israels, jedoch weder eine ausführliche Landeskunde oder
Archäologie Palästinas/Israels noch eine »Geschichte Israels«, obwohl Archäologie,
Geschichte und (biblische wie außerbiblische) Textzeugnisse und Literatur natürlich
ins Spiel kommen bzw. kommen müssten.
Auch die Bezüge zu religionsgeschichtlich bedeutenden Quellen, seien es Inschriften
oder die Einrichtung und Entwicklung von Kultstätten und Tempeln, werden nicht
systematisch hergestellt. Die Gesamtanlage des IPIAO-Projekts erlaubte eine solche
Ausdehnung nicht. Der Vorteil der Beschränkung sollte sein, dass die Auswahl der
Bilder möglichst wenig vom Wissen aus anderen Quellen gesteuert ist und dass die
Bilder nicht vorschnell mit den Aussagen anderer Quellen verquickt werden. Der
Objektkatalog sollte idealiter einen unabhängigen Quellenfundus bieten, auf den
Forschende zugreifen können. Alle Zusammenfassungen in den Einleitungen sind
skizzenhaft, wobei sie im Hinblick auf die Ikonographie Palästinas/Israels auf weite
Strecken an frühere Arbeiten insbesondere von Othmar Keel und Christoph Uehlinger
anschließen konnten. Aus dem umfangreichen Katalog und den Einleitungskapiteln
können voraussichtlich noch viele Entdeckungen gehoben werden, sei es durch
Klärungen von Zuordnungen, sei es durch Neufunde, die erhellend hinzukommen,
sei es durch Bezüge zu Quellen, die hier nicht in den Blick genommen werden konnten.
Zu danken ist an dieser Stelle dem Schweizerischen Nationalfonds, der bis August 2014
das IPIAO-Forschungsprojekt mit zwei 50%-Assistenzstellen und der Finanzierung
einer Hilfskraft maßgeblich unterstützte.
Ich danke – in der Reihenfolge des Beginns ihrer Anstellungszeiten – Barbara Hufft
(Basel), Florian Lippke (Fribourg), Philipp Frei (Bern) und Patrick Wyssmann (Bern)
für ihre Mitarbeit auf allen Ebenen des Projekts. Barbara Hufft und Philipp Frei haben
Teile der Einleitung (Kulturgeschichtliche Horizonte) selbstständig verfasst.
Die meisten neuen Umzeichnungen, die für diesen Band erstellt wurden, stammen
von Myriam Röthlisberger (Bern), die in kurzer Zeit ihr Talent für das Zeichnen nicht
nur entdeckte, sondern auch ganz rasch zu einer erstaunlichen Perfektion entwickelte.
Größere Gruppen von Umzeichnungen wurden zudem von Ulrike Zurkinden-Kolberg
(Düdingen), Philipp Frei und Salim Staubli angefertigt.
Bei der Beschaffung von fehlenden Daten und ungezählten Korrekturgängen und
Arbeiten an der Herstellung von Registern und Verzeichnissen haben Philipp
Frei, Barbara Hufft, Julia Müller-Clemm, Ulrike Münger, Ursin Raffainer, Myriam
Röthlisberger und Patrick Wyssmann keine Mühe gescheut. Ohne auswärtige Hilfe
der Verantwortlichen in Behörden, Museen und Universitäten, insbesondere in Israel,
wären wir nicht ausgekommen. So gilt der Dank auch all jenen, die uns unterstützt
haben und Geduld für große und kleine Anfragen aufbrachten:
8
Alegre Savariego (Rockefeller Museum, Israel Antiquities Authority)
Debora Ben-Ami, Michael Sebbane (Israel Antiquities Authority)
Arina-Laura Peri, Daphna Ben-Tor, Eran Arie (Israel Museum)
Baruch Brandl (Rockefeller Museum Library)
Irit Ziffer, Nitza Bashkin Joseph (Eretz Israel Museum)
Filip Vucosavovic (Bible Lands Museum Jerusalem)
Nigel Tallis und Rupert L. Chapman (British Museum)
Stephanie Brown (Badè Museum of Biblical Archaeology, Berkeley)
Helen McDonald (Oriental Institute Museum)
Klaus Finneiser (Ägyptisches Museum Berlin)
David Ilan (Hebrew Union College)
Leonardo Pajarola (BIBEL+ORIENT Museum, Freiburg CH)
Tallay Ornan, Amihai Mazar, Shua Kisilevitz, Yosef Garfinkel (Hebrew University)
Liora Freud, Débora Sandhaus, Ido Koch (Tel Aviv University)
Oz Varoner (Ben-Gurion University of the Negev)
Itzick Shai (Bar-Ilan University Ramat Gan)
Daniel Master (Wheaton College)
Giuseppe Minunno (Università degli Studi di Firenze)
David T. Sugimoto (Keio University)
Dieter Vieweger, Jutta Häser (Biblisch-Archäologisches Institut Wuppertal)
Peter Fischer (Universitäten Göteborg und Wien)
Christian Herrmann (Gachnang)
Martin Klingbeil (Southern Adventist University)
Stefan Münger (Universität Bern)
Claudia E. Suter (Universität Basel)
Robert Deutsch (Jaffa)
Die kompetente Verarbeitung der Dokumente und Bildvorlagen zu einem Buch lag
erneut ganz in Händen der Geschwister Julia und Alexander Müller-Clemm. Ihr
Know-how ist einzigartig und die wunderbare Zusammenarbeit mit ihnen hat es
ermöglicht, die Hürden eines solch großen Projekts überhaupt zu bewältigen.
Benny Mosimann hat sich erneut um die Covergestaltung gekümmert und unsere
großen und kleinen Wünsche zu erfüllen versucht.
Maurice Greder hat sich über das bedauerliche Ende des Verlags Academic Press
hinaus für die Fertigstellung und Publikation von IPIAO 4 persönlich engagiert. Dem
Schwabe Verlag danken wir für die Übernahme von IPIAO und die Betreuung in der
letzten Phase, dem Schweizerischen Nationalfonds für die finanzielle Unterstützung
der digitalen Publikation des Bandes.
Allen, die mitgewirkt haben an diesem Riesenwerk, gilt Dank und Applaus.
Silvia Schroer (Bern, im März 2018)
Korrespondenzadresse: Prof. Silvia Schroer, Theologische Fakultät, Länggassstr. 51,
3012 Bern (silvia.schroer@theol.unibe.ch)
9