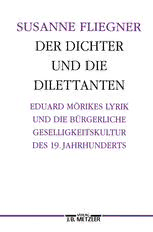
Der Dichter und die Dilettanten: Eduard Mörike und die bürgerliche Geselligkeitskultur des 19. Jahrhunderts PDF
Preview Der Dichter und die Dilettanten: Eduard Mörike und die bürgerliche Geselligkeitskultur des 19. Jahrhunderts
C"l GEtTl R:<l s:: MA:>-N~ IS'" T::l IS'" n C::t HEtTl >-ABtc H::t A:>-z NDCI Lt"" c: Uz NGCl EtTl Z N 0 DEtTl R:<l 0 D;:; ICH::t ..., TEtTl R:<l c: UZ NDCI CI Dt;; IE 0 DIt= LE..., tTl T..., T:>-Az N..., TEtTl Z N SUSANNE FLIEGNER Der Dichter und die Dilettanten Eduard Mörike und die bürgerliche Geselligkeitskultur des 19.Jahrhunderts J. B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG STUTTGART GERMANISTISCHE ABHANDLUNGEN 68 CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Fliegner, Susanne: Der Dichter und die Dilettanten: Eduard Märike und die bürgerliche Geselligkeitskultur des 19.Jahrhunderts / Susanne Fliegner. - Stuttgart : Metzler, 1991 (Germanistische Abhandlungen; 68) ISBN 978-3-476-00750-6 NE:GT ISBN 978-3-476-00750-6 ISBN 978-3-476-03354-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-476-03354-3 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzuläs· sig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © 1991 Springer-Verlag GmbH Deutschland Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und earl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1991 VORWORT Ungefährliche Vorformen bürgerlicher Emanzipation finden Anfang des 19. Jahrhunderts in ästhetischen Betätigungen und im Rahmen geselliger Veranstaltungen statt. Innerhalb dieser bürgerlichen Bewegung spielt ein eher idyllisch verklärter Dichter wie Eduard Mörike eine bisher wenig beachtete Rolle. Geselligkeit - auch wenn sie häufig nur fiktiv gemeint ist - ist ein wichtiges Element seiner späteren Dichtung, sowohl von der Tradition, als auch von ihrer Wirkungsabsicht her. Aus diesem Grund lohnt sich eine sozial psychologische Betrachtungsweise, die, angeregt von Gerhart von Graevenitz' Studie über "Eduard Mörike: Die Kunst der Sünde", vom Freundeskreis der Tübinger Studienzeit ausgeht und sich bis auf die europäische Kunsthandwerksbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstrecken wird. Seit Beginn seiner Pfarrtätigkeit in Cleversulzbach ist Mörikes Lebenssituation entscheidend vom Wechsel zwischen körperlicher Krankheit und diätetischer Schutzmaßnahme geprägt. Sein ständiges "Kränkeln" zwingt ihn zum Rückzug auf sich selbst und seine Familie und schließlich 1843 zur Aufgabe seines Pfarramtes. Da in einer solchen Lage wenig an dichterische Produktion zu denken ist, wendet sich Mörike zweitrangigen ästhetischen Be schäftigungen zu: der Herausgabe antiker Dichtung, dem Sammeln von Ver steinerungen und schließlich dem Kunsthandwerk. Dabei läßt sich entdecken, daß diese scheinbar privaten Steckenpferde Mörikes ihre Parallele in den gleichzeitigen Kulturprogrammen des bürgerlichen Dilettantismus haben, wie er sich überall in Deutschland in Geschichts-, Gesangs- und Museumsvereinen organisiert. In solchen Spielräumen sozialer Macht, wie sie das Vereinsleben bietet, kann Mörike für seine verspielten Formen ein Daseinsrecht finden -und sich dennoch heimlich durch die Dichtung dieser Zeitgenossenschaft entziehen. INHALT ERSTER TEIL: MÖRIKES DICHTUNG I. Der Zusammenhang von Krankheit, Diätetik und dichterischem Rollenverständnis bei Mörike.............................................. 3 1. Refugien .................................................................................................. 10 2. Die Hypochondrie................................................................................... 16 Exkurs: "die Musen saugen einen aus" -der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe ................................................... 20 3. Dichterischer Rollenwechsel................................................................. 27 Exkurs: Vom Sänger zum poeta doctus........................................ 30 II. Das neue Programm: die Antike........................................................................ 37 1. "Die Herbstfeier" ........................................... .......................................... 38 2. "Amors goldglänzende Tinte" ................................................................ 45 a) Mörikes Briefwechsel mit Hermann Kurz .............................. 45 b) Erotica.......................................................................................... 50 IlI. Poesie des Gedenkens: Mörikes spätere Dichtung.......................................... 57 1. "Auf das Grab von Schillers Mutter" .................................................... 57 Exkurs: Das Spiel mit dem Ersatz -Mörikes Kindheitsrituale ................................. .......................................... 68 2. Vergegenständlichung -drei Gedichte an Wilhelm Hartlaub .......... 74 3. Verewigung des Alltäglichen: die Gelegenheitsgedichte .............. ..... 83 4. Weitere Gedenktraditionen................................................................... 88 Zusanznzen!assung und Ausblick ........................................................................... 94 ZWEITER TEIL: MÖRIKES BÜRGERLICHE ZEITGENOSSEN I. Das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Dilettanten ...................................... 101 1. Der bürgerliche Kunst- und Kulturmarkt........................................... 106 2. Der Historismus ..................................................................................... 110 II. Das bürgerliche VereinsweseIl -der organisierte Dilettantismus .................... 114 1. Stuttgarter Vereine: a) Georgiis Kegelgesellschaft........................................................ 116 b) Die Museumsgesellschaft ......................................................... 117 c) Liederkranz und Schillerverehrung ......................................... 121 2. Das ästhetische Programm der bürgerlichen Vereine: ..................... 125 a) Klassizismus ............................................................................... 125 b) Historische Kunst .............. ............................. ....... ...... .... .......... 127 c) Denkmalskult ............................................................................. 130 Zusammenfassung und Ausblick .......................................................................... 136 DRITTER TEIL: SPIELRÄUME DES HISTORISMUS - MÖRIKES ÄsTHETISCHE NEBENBESCHÄFTIGUNGEN I. Übersetzungs- und Herausgebertätigkeit ............................................................ 141 1. "eine kleine Zwischenarbeit, compilatorischer Natur" ..................... . 141 2. Die Bedeutung des Gartenmotivs in Mörikes Gedichten: .............. . 149 a ) "G0" tt erW.l n k" ............................................................................. .. 153 b) "Ach nur einmal noch im Leben!" .......................................... . 157 c) Der Garten des Philologen ..................................................... .. 159 Il. Sammlertum und populäre Wissenschaft ........................................................ 163 1. Leidenschaftliche Betriebsamkeit -Mörike als Petrefaktensammler .............................................................................. 167 2. "Das ist auch wohl Poesie" -zur Ästhetik ........................................... 172 111. Kunst und Handwerk ....................................................................................... 179 1. Die neue Bedeutung des Kunsthandwerks......................................... 181 2. "Ein Kunstgebild der echten Art" -Mörikes kunsthandwerkliches Interesse ............................................................... 188 a) die antike Kleindichtung........................................................... 192 b) "Der alte Turmhahn"................................................................. 193 c) "Bilder aus Bebenhausen" ......................................................... 195 3. "Was ich als Dichter nicht erworben, Verdien ich mir als Hafner noch" .................................................................................... 198 Schluß ...................................................................................................................... 208 Abkürzungen .......................................................................................................... 213 Literaturverzeichnis............................................................................................... 215 Abbildungsnachweis .............................................................................................. 223 Erster Teil Mörikes Dichtung I. DER ZUSAMMENHANG VON KRANKHEIT, DIÄTETIK UND DICHTERISCHEM ROLLENVERSTÄNDNIS BEI MÖRIKE 1833 beklagt sich Friedrich Theodor Vischer in einem Brief an seinen Freund Eduard Mörike über die ihm vorbestimmte theologische Laufbahn, und er kommt zum bitteren Schluß: So viel ist mir ganz klar, daß ich mein Leben verfehlt habe, wenn ich ein Theolog bleibe.! Mörike, der schon seit sieben Jahren als Vikar über die WÜTUembergischen Dörfer zieht, kennt die Leiden seines Freundes selbst nur zu gut und zieht eine ähnlich düstere Bilanz: Du hast freilich das alte Geschwür, womit wir beide, und andre brave Leute mit uns, unschuldigerweise gestraft sind, sogleich am rechten Fleck berührt; Gott weiß wie tief ich dabei aufgeseufzt habe. Indeß gelang mirs doch seit mehrem Jahren, den bösen Schaden vor mir selbst noch ganz erträglich zu bedecken, und wenn ich auch sehr deutlich fühle, daß von s c h ö n e r Produktivität, der Natur der Sache nach, neben dem KirchenRock eigentlich gar nichts aufkommen kann, so hat doch eine gewisse Indolenz und Liebe zur Bequemlichkeit mich dergleichen Klagen immer seltener führen lassen.2 Mörike fühlt sich durch das Kirchenamt "unschuldigerweise gestraft", denn schon in seiner frühen Jugend hatte man diesen Beruf für ihn ausgewählt. Nach dem Tod des Vaters (1817) stand die Familie völlig mittellos da, angewiesen auf die Hilfe von Verwandten. Unter diesen Umständen hielt man es für das Beste, Eduard für die Theologie zu bestimmen, da die Pfarrausbildung vom württembergischen Staat bezahlt wurde. In einer landesweiten Aufnahmeprü fung, an der sich Kinder aus allen Schichten beteiligen durften, erhielten die Besten, oder wie im Falle Mörikes, die Gutartigen und (Halb-)Waisen, ein Sti pendium3: die 12-14 Jahre alten Jungen wurden zuerst vier Jahre lang in einem der "Niederen theologischen Seminarien", in Blaubeuren, Maulbronn, Urach oder Schönthai unterrichtet. Im Anschluß daran absolvierten sie ihr Theologiestudium in Tübingen. Zwar mußten sich die Stipendiaten ver pflichten, die evangelische Pfarrlaufbahn einzuschlagen, doch bestand die Mög lichkeit, sich durch Erstattung der Ausbildungskosten vom Kirchenrock Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor Vischer, hrsg. v. Robert Vischer (München 1926), S. 99 2 Mörike an Vischer, Ochsenwang, 5. Oktober 1833 (Werke XII, S. 44) 3 Eduard Mörike 1804. 1875. 1975, Katalog zur Gedenkausstellung zum 100. Todestag im Schil ler-Nationalmuseum Marbach a. Neckar, hrsg. v. Bemhard Zeller el. al. (Stuttgart 1975), S. 52ff 4 Krankheit, Diätetik und dichterische Rolle "freizukaufen".4 So hatte sich Mörike 1828 vom Vikariatsdienst beurlauben las sen und versucht, als Bibliothekar, Hofmeister und Journalist sein Auskommen zu finden. Doch seine Hoffnung, dadurch einen größeren Freiraum für seine dichterischen Zwecke zu gewinnen, erfüllte sich nicht, und er kehrte nach ei nem Jahr wieder reumütig ins Vikariat zurück. Wie Mörikes Brief an Vischer aus dem Jahre 1833 zeigt, ist ihm in den fünf Jahren seiner Wiederaufnahme des Vikarsdienstes der Sprung vom abhängigen Gehilfen zum selbstständigen Pfarrherrn nicht gelungen. Dabei wird die Forde rung der Familie, eine finanziell unabhängige Position zu erreichen, zunehmend dringlicher, denn seit dem Tod des Vaters erhoffen sich die weiblichen Famili enmitglieder die Versorgung durch die Söhne und Brüder. Auf Eduard, dem Zweitältesten, der eine sichere Pfarrexistenz anstrebt, ruht schließlich von 1831 an die ganze Last eines Familienoberhaupts: der bisher vorbildliche ältere Bru der Karl wird seines Amtes enthoben und wegen Erpressung, Unterschlagung und Verleumdung zu einer einjährigen Festungshaft auf dem Hohenasperg ver urteilt. Von nun an wird die unsichere Existenz Karls eine große Belastung für Mörike sein: der Bruder hat nur noch kurzfristige Anstellungen inne, dazwi schen erhält er für nachfolgende Verfehlungen wieder Gefängnis- und schließ lich sogar Arbeitshausstrafen; mittellos lebt er oft monatelang als Gast im Mö rikeschen Pfarrhaus. Ähnlich unruhig und für Mörike belastend verlaufen die Lebensbahnen von Adolf und Ludwig, Mörikes jüngeren Brüdern.5 Ihr Eintritt Ebd., S. 53ff und S. 60-62 5 Ein kurzer Überblick über die Entwicklung von Mörikes Brüdern an hand von Hans-Ulrich Si mons Mörike~Chronik (Stuttgart 1981): Karl Mörike (1797-1848): seit 1823 Amtmann auf dem Gut des Fürsten v. Thurn u. Taxis in Scheer an der Donau (S. 30), 1829 Beginn der beruflichen Schwierigkeiten (S. 58); 1830 hängt Karl, um seinen Ruf bei seinen Vorgesetzten zu verbessern, in den Nachbarorten von Scheer aufrührerische Plakate auf, die er dann selbst "entdeckt" (S. 68). Er wird durchschaut, darauf hin 1831 seines Amtes enthoben und erhält ein Jahr Festungshaft auf dem Hohen Asperg "wegen 'grober Täuschung der Staats-Regierung' aus 'sträflicher Ehrsucht'"(S. 72). Nach seiner Entlassung wohnt er fast ein Jahr lang bei Mörike in Ochsenwang. 1833 wird er Assistent bei der Abgeordnetenkammer in Stuttgart, die er nach erneuten Schwierigkeiten 1834 ohne Kün digung verläßt usw. (S. 86). 1836 wird wieder gegen ihn wegen versuchter Erpressung und Verleumdung ermittelt (S. 93), und er wird verhaftet, 1838 hat er seine Strafe abgesessen (S. 108). Bald darauf will er sich an einer Familienerbschaft bereichern und fälscht ein Testament -dafür wird er 1840 schließlich zu 3 1/2 Jahren Arbeitshaus verurteilt (S. 121). August Mörike (1807-1824): als Apothekerlehrling in Ludwigsburg verübt der Siebzehnjährige vermutlich Selbstmord (S. 34). Adolf Mörike (1813-1875): 1833 nach Abschluß seiner Schreinerlehre will sich Adolf selbstän dig machen und leiht sich von Mörike Geld; Mörike nimmt deshalb ein Darlehen auf, das er erst 1846 zurückzahlen kann! (S. 85) 1836 wenden sich weitere Schuldner von Adolf wegen des sen Zahlungsunfähigkeit an Mörike, der die Zahlungsverpflichtung seines Bruders übernimmt
