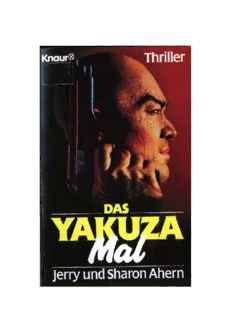
Das Yakuza-Mal PDF
Preview Das Yakuza-Mal
Inhalt: Einer der gefährlichsten Gangster Chicagos ist bereit, ein neues Leben anzufangen. Seine Bedingung: Sein Enkel, der von der Yakuza, der japanischen Mafia, gefangengehalten wird, muß freigelassen werden. Plötzlich findet sich der Polizist Ed Mulvaney in der düsteren Welt der Verbrechen, des Drogenhandels, des schlüpfrigen Sex und des raffinierten Tötens wieder: in der Welt der Ninja. Jerry und Sharon Ahern: Das Yakuza-Mal Roman Aus dem Amerikanischen von Andrea Galler Deutsche Erstausgabe November 1990 © 1990 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Titel der Originalausgabe »The Yakusa Tattoo« © 1988 Jerry und Sharon Ahern Originalverlag Pocket Books, New York Umschlaggestaltung Manfred Waller Satz Compusatz GmbH, München Druck und Bindung brodard & taupin Printed in France 54321 ISBN 3-426-02908-1 1 Eiskalt Eisschollen lagen auf schmutzigbraunem Schnee. Wo der Schnee sich noch nicht mit dem verdreckten Schneematsch vermischt hatte, lag eine zweite Schicht von verharschtem Schnee. Wälle aus Schneematsch türmten sich auf und wirkten wie eine Bastion, die gegen einen Feind errichtet worden war. Die Wälle wurden nur durch die geräumten Einfahrten in den Parkplatz unterbrochen. Seit zehn Tagen hatte es unablässig geschneit. Über Nacht schneite es meist nur leicht. Aber immer in der Hauptverkehrszeit, nachmittags um fünf, wenn große Straßen wie die Ryan, die Kennedy oder die Ike schon wieder verstopft waren und der Verkehr sich von den Auffahrtsrampen bis in die Zubringerstraßen rückstaute, fing es wieder heftig zu schneien an. Dann trieb ein starker Wind dicke Flocken vom See in die Stadt. Die Schwarzen von der South Side nannten den Wind den Falken, weil er Krallen zu haben schien, die man durch die Kleider zu spüren glaubte. Wen der Falke fest im Griff hatte, den ließ er nicht mehr los, ehe er nicht die Haustür hinter sich zumachen konnte. Und den Leuten von der Straße, die weder bei der Heilsarmee noch bei einer der Sozialstationen einen Schlafplatz gefunden hatten, bohrten sich die Krallen so tief ins Fleisch, daß sie manchmal daran starben. Er hatte die Jagdbeute des Falken gesehen: Sie hatten je nach ihrer ursprünglichen Hautfarbe gelbe oder graue Gesichter mit blau hervortretenden Adern. Der Falke war ein Gleichmacher - Rasse, Religion oder Herkunft scherten ihn nicht. Er fragte sich, wie ein gutgenährter, gesunder Mann, der in eine Decke gehüllt und vor dem Wind geschützt war, so frieren konnte. »Lew, ich spüre die Zehen an meinem linken Fuß nicht mehr.« »Stampf mit dem Fuß auf.« Er stampfte auf, und Lewellyn Fields knurrte: »Mulvaney, du Hurensohn!« »Was sagst du da über meine Mammy, Mann?« »Quatsch nicht wie ein Nigger. Und wenn du schon noch mal stampfen mußt, dann bitte nicht auf meinen Fuß.« Mulvaney schaute unter seiner Decke hervor zum geöffneten Fenster der Fahrerseite des Fords hinaus. Auf dem Parkplatz war nicht viel zu sehen, nur Eis und Schnee und ein halbes Dutzend Autos. Er blickte über die Rückenlehne des Vordersitzes nach vorne. Ihr Atem war auf der Windschutzscheibe zu blauen und frostgrauen Flecken gefroren, doch zwischen den Flecken hindurch konnte er das massige Grau des Naturkundemuseums am Ende des Parkplatzes erkennen. Er fragte sich, ob wohl von den im Museum ausgestellten Tieren einige auch erfroren waren. Das Zifferblatt seiner Armbanduhr war vereist. Er trug Handschuhe und rieb es mit dem Knöchel seines rechten Daumens frei. Dann zog er sein Handgelenk wieder in den Ärmel seiner Windjacke zurück und sagte zu seinem Partner: »Fast halb sieben.« »Zwei volle gottverdammte Stunden?« »Die Zeit verfliegt einfach, wenn man sich gut amüsiert, findest du nicht auch?« Mulvaney versuchte, seine Zigaretten zu finden, ohne seine Handschuhe ausziehen zu müssen. »Was, zum Teufel, haben wir hier eigentlich verloren?« »Wir wollen ein paar Drogenhändler hochgehen lassen.« »Ich weiß, aber warum ausgerechnet wir?« »Weil wir Polizisten sind. Wenn wir nicht hin und wieder jemanden festnehmen, bezahlen sie uns nicht mehr oder versetzen uns ins Fundbüro oder ins Archiv. Was suchst du eigentlich?« »Meine Zigaretten.« »In meiner Tasche sind sie ganz bestimmt nicht, du Idiot.« »Ach so ...« Mulvaney suchte weiter. Als er das Päckchen gefunden hatte, schüttelte er eine Zigarette heraus und steckte sie in den Mund. »Möchtest du eine?« »Ich hab's aufgegeben - na gut, gib mir eine.« Mulvaney reichte ihm das Päckchen. Lew Fields nahm sich eine Zigarette und gab ihm dann das Päckchen wieder zurück. »Hast du Feuer, Lew?« »Ich hab dir doch gesagt, daß ich aufgehört habe. Wo ist dein Feuerzeug? Vor ein paar Minuten hab ich es noch gesehen.« »Moment.« Mulvaney suchte weiter. »Na also, da haben wir's ja.« »Dein Feuerzeug?« »Nein, aber den dritten Schnellader. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause vergessen. Er war in meiner Manteltasche.« Mulvaney zog ihn heraus. Der Schnellader war voller Tabakkrümel und Fusseln. Er blies die Patronen frei und steckte ihn dann in die Tasche seines Sportsakkos zu den anderen beiden Schnelladern. Schließlich fand er auch das Feuerzeug: »Hier bitte.« Er mußte das Zündrädchen mehrmals betätigen. »Was ist eigentlich mit Harvey los?« Fields stieß graue Rauchwolken aus und hustete. Es war so kalt, daß der Rauch ähnlich aussah wie sein Atem. »Harvey?« »Ja, Harvey: Sein Haus muß mindestens 175 000 Dollar gekostet haben. Wenn nicht mehr.« »Vielleicht hat seine Frau Geld.« »Quatsch. Ich bin mit Carol aufgewachsen. Ihr alter Herr war Taxifahrer. Harvey nimmt Schmiere.« »Nur weil ein Bulle ein schönes Haus hat, heißt das noch lange nicht...« »Ein schönes Haus. Einen Cadillac. Sportreifen. Weißt du eigentlich, was ein Satz Reifen für so einen Schlitten kostet?« »Okay, dann läßt Harvey sich eben von jemandem schmieren. Ist doch großartig für Harvey.« »Mir sind auch Bestechungsgelder angeboten worden.« Fields schaute ihn unter der Decke an. »Vielleicht könnte jemand auf die Idee kommen, daß du auch Nebeneinkünfte hast, wenn er deinen alten Porsche sieht. Also, schrei lieber nicht so laut herum.« »Alt ist er, da hast du recht, Lew.« »Für seine zehn Jahre steht er noch ganz gut da, bei dem Salz und dem anderen Zeug, das sie auf die Straßen schmeißen.« Mulvaney nickte. An seinem rechten Knie war eine kalte Stelle. Er zog sich die Decke enger um die Beine. Das Geld für den Porsche hatte er sich in Vietnam zusammengespart, als er dort den Dschungelrambo gespielt hatte. Bei den heutigen Preisen könnte er sich in tausend Jahren keinen Porsche leisten. Aber das »Badewannen«-Design des Wagens hatte sich in all den Jahren nur wenig verändert. Und weil Mulvaney sein Fahrzeug mit größter Sorgfalt pflegte, konnte es jetzt beinahe schon als Oldtimer gelten. Mulvaney waren vor einem Jahr 30 000 Dollar für den Wagen geboten worden, und der Rechtsanwalt seiner Frau hatte ihn zwingen wollen, den Wagen zu verkaufen, damit der Erlös bei der Scheidung aufgeteilt werden konnte. Der Wagen ... Er erkannte plötzlich, daß der Porsche wirklich eine Art Symbol für ihn war, als erzähle er die Geschichte seines Lebens - eines Krieges. Es war ein Krieg, den Collegeabschluß zu machen, ohne zum Militär zu müssen. Dann kam der Krieg in Vietnam, den außer den kämpfenden Männern keiner gewinnen wollte. Und aus dem Mädchen seiner Träume war genau die Art von Frau geworden, die einem sonst nur in Alpträumen begegnet. Dann ein weiterer Krieg vor dem Scheidungsgericht. Und den Wagen ständig in Schuß zu halten. Alles war ein permanenter Kampf - ein Krieg Edgar Patrick Mulvaneys gegen die Naturgewalten und gegen die Stadt Chicago. Im Frühjahr füllten sie die Schlaglöcher mit einem Zeug, das im nächsten Winter wieder herausbröckelte, und man krachte in die Schlaglöcher, zerschlug sich den Frontspoiler und ruinierte die Reifen. Im nächsten Frühjahr besserten sie die Schlaglöcher dann wieder aus, das Zeug blieb in Klumpen an den Spritzlappen hängen, und man mußte es wieder mühsam entfernen. Im Winter warfen sie überall Salz auf die Straßen, und wenn man den Wagen waschen ließ, froren die Schlösser ein. Dann kniete man vor der Wagentür und blies warme Luft in das Schloß, daß jeder beim Vorbeifahren dachte, man wolle seinem Liebling einen blasen. Und meistens half das alles ohnehin nichts. Dann mußte man auch noch heißes Wasser auftreiben oder den Autoschlüssel mit dem Feuerzeug anwärmen. Im Dienst, und zu oft auch außerhalb der Dienstzeiten, verfolgte man bewaffnete und gefährliche Idioten, weil man dafür Freischichten bekam. Das heißt, wenn man überhaupt mal einen Tag freihatte und nicht vor Gericht erscheinen und zusehen mußte, wie das Verfahren eingestellt wurde. Dann setzten sie den Typ, den man festgenommen hatte, wieder auf freien Fuß, nur damit man ihn später wieder festnehmen konnte. Er bekämpfte die Mächte der Gesetzlosigkeit nicht etwa aus ethischen Prinzipien, sondern weil sonst die Gehaltszahlungen eingestellt würden und er das Haus verkaufen müßte, das er von einer Tante geerbt hatte, die ihn zeit ihres Lebens nicht hatte ausstehen können. Er erinnerte sich wieder an seine eigene Zigarette, zündete sie an, stieß Rauch und feuchten Dampf aus und sagte dann zu Lew: »Du hast vergessen, mir zu meinem Jahrestag zu gratulieren. Du bist mir ein schöner Freund.«
