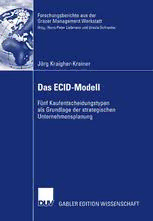
Das ECID-Modell: Fünf Kaufentscheidungstypen als Grundlage der strategischen Unternehmensplanung PDF
Preview Das ECID-Modell: Fünf Kaufentscheidungstypen als Grundlage der strategischen Unternehmensplanung
Jörg Kraigher-Krainer Das ECID-Modell GABLER EDITION WISSENSCHAFT Forschungsberichte aus der Grazer Management Werkstatt Herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. Hans-Peter Liebmann und Universitätsprofessorin Dr. Urusla Schneider, Karl-Franzens-Universität Graz In dieser Schriftenreihe werden Forschungsergebnisse präsentiert, die Orientierungshilfen und Gestaltungsempfehlungen für die Unter- nehmensführung bieten. In der Grazer Management Werkstatt wird an entwicklungsfähigen und praxistauglichen Konzepten für die Wei- terentwicklung der Betriebswirtschaftslehre und der betrieblichen Praxis gearbeitet. Jörg Kraigher-Krainer Das ECID-Modell Fünf Kaufentscheidungstypen als Grundlage der strategischen Unternehmensplanung Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans-Peter Liebmann und Prof. Dr. Ursula Schneider Deutscher Universitäts-Verlag Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. Habilitationsschrift Karl-Franzens-Universität Graz, 2005 1. Auflage Dezember 2007 Alle Rechte vorbehalten © Deutscher Universitäts-Verlag | GWVFachverlage GmbH, Wiesbaden 2007 Lektorat: Frauke Schindler /Stefanie Loyal Der Deutsche Universitäts-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. www.duv.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbe- sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. indiesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany ISBN 978-3-8350-0979-0 Geleitwort Revolutionen beginnen lange bevor sie öffentlich ausgerufen werden. In diesem Sinn wollen die Forschungsberichte aus der Grazer Management Werkstatt eine Plattform für Neues sein. Wir gehen von der These aus, dass Betriebswirtschaftslehre ihre Paradigmen und Anregungen zu deren Wandel oft aus anderen Disziplinen bezogen hat. Echte Innovationen liefert sie nur mehr selten, und wo sie innoviert, vermag sie nicht zu vermarkten und gibt ihre Vertreter an den Beratungsmarkt ab. Dort, wo sie nur verfeinert, ist das Verhältnis von Forschungsauf- wand zu Erkenntnisschöpfung ungünstig geworden. Die Buchreihe Forschungsberichte aus der Grazer Managementwerkstatt will dieser Ent- wicklung entgegentreten: Als Forum für ein innovatives Verständnis der Betriebswirtschafts- lehre als Integrationswissenschaft. Wir sprechen dabei bewusst von Werkstatt, weil wir an schweißtreibende Denkarbeit denken, nicht an Schreibtischarbeiter im Ärmelschoner, denen es wegen geistigen Hedgings von vornherein an thrill, an jenem unbändigen Abenteuer fehlt, das Forschung an der Grenze zum Neuen bedeutet. Der vorliegende Beitrag von Jörg Kraig- her-Krainer passt gut in dieses unser Konzept, weil er innovativ und fundiert zugleich ist, ge- trieben durch forscherische Neugierde, aber auch durch wissenschaftliche Sorgfalt. Der Autor setzt sich zum Ziel, ein neues Modell zur Erklärung unterschiedlicher Kaufverhal- tenstypen bzw. des im Marketing häufig verwendeten Konstrukts Involvement konzeptionell zu entwickeln und empirisch zu testen. Dabei werden systematisch vorliegende konzeptionel- le Modelle gegeneinander abgewogen und in ein neues Involvement-Modell integriert. Dieses Modell unterscheidet sich im wesentlichen in drei zentralen Aspekten von bisherigen Ansät- zen: Erstens postuliert der Autor einen Paradigmenwechsel in der Erwartung üblichen Kauf- verhaltens, indem das primäre Entscheidungsmuster habitueller Natur ist und nicht expliziten Entscheidungsheuristiken folgt. Zweitens unterscheidet das vorgestellte ECID-Modell zwi- schen einem emotionalen (intrinsische vs. extrinsische Motivation) und einem kognitiven (perceived risk) Antezedens von Involvement. Drittens ergibt sich daraus die Möglichkeit, eine bisher im Rahmen der Involvementforschung nicht diskutierte Entscheidungsheuristik, das Stellvertretende Kaufverhalten, zu integrieren. Die Relevanz der Arbeit ist aus mehreren Perspektiven zu begründen. Der Autor zeigt in an- schaulicher Weise, aufbauend auf einer systematischen Literaturanalyse, die konzeptionellen Lücken der bisherigen Involvementforschung auf und leistet so einen Beitrag zur kritischen Strukturierung des state of the art. Die theoriegeleitete Modellentwicklung erlaubt eine Ein- V ordnung der Arbeit als konzeptionellen Beitrag in der Involvementforschung, der mittels eines erweiterten Modells Kaufverhalten ganzheitlich zu erklären versucht. Die vorgelegte empiri- sche Fundierung des Konzeptes legt schließlich sowohl die Basis für weitere wissenschaftli- che Studien, die zur nomologischen Validierung auf das Konzept zurückgreifen können, als auch für die Praxis, indem das Modell für die Lösung praktischer Probleme unterschiedlicher Branchen eingesetzt werden kann. Bei der Arbeit von Jörg Kraigher-Krainer handelt es sich um einen wissenschaftlichen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt in der Käuferverhaltensforschung. Das Konzept des rational han- delnden Entscheiders wird vehement in Frage gestellt, weil der Entscheider grundsätzlich dazu tendiert, auf vorgefertigte Handlungsmuster zurückzugreifen. Das ist ein Standpunkt, welcher Widerspruch provozieren kann und mit der vorliegenden Literatur in Einklang zu bringen ist. Kraigher-Krainer lässt aber die resultierenden Fragen nicht offen, sondern macht sich bei seinen Lösungsvorschlägen Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie der Ky- bernetik, des radikalen Konstruktivismus, der Lerntheorie, der Kundenzufriedenheitsfor- schung und der Kauftypenforschung zunutze und verbindet diese geschickt zu einem neuen Vorschlag zum Verständnis von Kaufentscheidungssituationen. Hans-Peter Liebmann Ursula Schneider Institut für Handel, Absatz und Marketing Institut für Internationales Management Universität Graz Universität Graz Universitätsstraße 15/G3 Universitätsstraße 15/G1 A-8010 Graz A-8010 Graz e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] VI Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ..............................................................................................................................1 1.1 Das beobachtete Ausgangsphänomen ..............................................................................1 1.2 Die bisherigen Erkenntnisse im Überblick .......................................................................2 1.3 Möglicher Nutzen des vorliegenden Forschungsprojektes ............................................14 1.4 Methodologische Überlegungen zur Arbeit ...................................................................15 1.5 Forschungsfragen ...........................................................................................................19 2 Die Entwicklung des ECID-Modells .................................................................................21 2.1 Modellbildung ................................................................................................................21 2.2 Abgrenzung des Involvementbegriffs ............................................................................29 2.3 Das emotive Antezedens von Involvement ....................................................................36 2.4 Das kognitive Antezedens von Involvement ..................................................................38 2.5 Involvement an sich und Arten von Involvement ..........................................................43 2.6 Aus den Involvementarten resultierende Verhaltenskonsequenzen ...............................45 2.7 Zusammenfassung und Überleitung zu Kapitel 3 ..........................................................49 3 Operationalisierungsmöglichkeiten im Überblick ..........................................................51 3.1 Operationalisierungsvorschläge im Rahmen verbaler Messungen ................................52 3.1.1 Operationalisierungsvorschläge für das EIM-Konstrukt ..........................................56 3.1.2 Operationalisierungsvorschläge für das PR-Konstrukt ............................................56 3.1.3 Operationalisierungsvorschläge für das Konstrukt Informations- und Kaufverhalten .............................................................................57 3.2 Operationalisierung mittels experimenteller Manipulation ............................................58 3.2.1 Experimentelle Manipulation von Intrinismus als UV .............................................58 3.2.2 Experimentelle Manipulation von Perceived Risk als UV .......................................59 3.2.3 Experimentelle Provokation von Informations- und Kaufverhalten als AV ...............................................................................................59 VII 3.3 Operationalisierungsvorschläge mittels Beobachtung und psychobiologischer Messung ..................................................................................60 3.4 Zusammenfassung und Überleitung zu Kapitel 4 ..........................................................64 4 Entwicklung einer Messmethode und empirische Modellprüfung ................................65 4.1 Studie 1 ...........................................................................................................................65 4.1.1 Ausgangsüberlegungen und Hypothesenformulierung ............................................66 4.1.2 Auswertung und Hypothesenprüfung .......................................................................73 4.1.3 Diskussion der Ergebnisse ........................................................................................79 4.2 Studie 2 ...........................................................................................................................83 4.2.1 Antezedenzien von Involvement ..............................................................................85 4.2.2 Resultierendes Verhalten als Folge von Involvement ..............................................91 4.2.3 Diskussion der Ergebnisse ......................................................................................107 4.3 Studie 3 .........................................................................................................................110 4.3.1 Fehlende Werte und Maßnahmen ...........................................................................113 4.3.2 Auszählung der Filterfrage und offene Antworten dazu ........................................114 4.3.3 Explorative Untersuchungen ..................................................................................118 4.3.4 Formulierung des Hypothesensatzes ......................................................................124 4.3.5 Konfirmatorische Prüfung des Hypothesensatzes ..................................................131 4.3.6 Diskussion der Ergebnisse ......................................................................................155 4.4 Studie 4 .........................................................................................................................162 4.5 Gütekriterien der Messung ...........................................................................................166 4.5.1 Objektivität und Reihenfolgeeffekte der Produktvorgabe ......................................166 4.5.2 Reliabilität der Messung .........................................................................................170 4.5.3 Validität der Messung ............................................................................................175 4.5.4 Übersicht zu den Gütekriterien der Messung .........................................................183 4.6 Zusammenfassung und Überleitung zu Kapitel 5 ........................................................185 VIII 5 Strategische und operative Implikationen .....................................................................187 5.1 Strategie, Positionierung und Kommunikation ............................................................188 5.2 Komplexität und Informationsüberlastung im Management .......................................196 5.3 Analysierbarkeit, Trivialität und das hermeneutische Prinzip .....................................214 5.4 Gewohnte Betrachtungsperspektiven und Brillen ........................................................220 5.5 Der Kunde über seine Wünsche von morgen ...............................................................229 5.6 Strategie als Wandel und Wandel als Schmerz ............................................................238 5.7 Operative Implikationen für das Management .............................................................242 5.8 Zusammenfassung und Überleitung zu Kapitel 6 ........................................................267 6 Kritische Bestandsaufnahme zum ECID-Modell ..........................................................270 6.1 Modewellen in Marketing und Käuferverhalten ..........................................................276 6.2 Diskussionsimpulse für die Forschung ........................................................................286 6.2.1 Motivation, Involvement und Perceived Risk ........................................................286 6.2.2 Versuch einer Bezugsetzung zwischen Emotionen und Kognitionen ....................289 6.2.3 Ansätze für die Kauftypenforschung ......................................................................292 6.2.4 Das ECID-Modell im Investitionsgütermarketing .................................................310 6.3 Einschränkungen der Gültigkeit des ECID-Modells ....................................................313 6.4 Offene Fragen und künftige Forschungsanstrengungen ...............................................317 6.5 Fazit ..............................................................................................................................320 Literaturverzeichnis ............................................................................................................323 Anhang .................................................................................................................................343 IX
