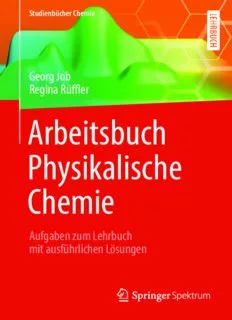Table Of ContentStudienbücher Chemie
Georg Job
Regina Rüffl er
Arbeitsbuch
Physikalische
Chemie
Aufgaben zum Lehrbuch
mit ausführlichen Lösungen
Studienbücher Chemie
Reihe herausgegeben von
Jürgen Heck, Hamburg, Deutschland
Burkhard König, Regensburg, Deutschland
Roland Winter, Dortmund, Deutschland
Die „Studienbücher Chemie“ sollen in Form einzelner Bausteine grundlegende und wei-
terführende Themen aus allen Gebieten der Chemie abdecken. Sie streben nicht unbe-
dingt die Breite eines umfassenden Lehrbuchs oder einer umfangreichen Monographie
an, sondern sollen Studierende der Chemie – durch ihren Praxisbezug aber auch bereits
im Berufsleben stehende Chemiker – kompakt und dennoch kompetent in aktuelle und
sich in rascher Entwicklung befindende Gebiete der Chemie einführen. Die Bücher sind
zum Gebrauch neben der Vorlesung, aber auch anstelle von Vorlesungen geeignet. Es
wird angestrebt, im Laufe der Zeit alle Bereiche der Chemie in derartigen Texten vorzu-
stellen. Die Reihe richtet sich auch an Studierende anderer Naturwissenschaften, die an
einer exemplarischen Darstellung der Chemie interessiert sind.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12700
Über den Autor
Georg Job studierte Chemie an der Universität Hamburg
und promovierte dort 1968 bei A. Knappwost. Von 1970 bis
2001 war er Dozent am Institut für Physikalische Chemie
der Universität Hamburg. Zwei Gastdozenturen führten
ihn an das Institut für Didaktik der Physik der Universität
Karlsruhe (1979–80) und an die Tongji-Universität in
Shanghai (1983).
Schon früh war ihm die Vereinfachung und
Vereinheitlichung der Wärmelehre ein großes Anliegen.
Dies mündete schließlich in die Veröffentlichung des
Buches „Neudarstellung der Wärmelehre“ im Jahre 1972.
Im Folgenden wurde das neue Lehrkonzept von G. Job konsequent weiterentwickelt und
in seiner Anwendung erweitert, so dass es letztendlich große Teile der physikalischen
Chemie umfasste. Es wurde von ihm in zahlreichen Artikeln und Vorträgen auf
nationalen und internationalen Tagungen vorgestellt. In Zusammenarbeit mit R. Rüffler
entstand schließlich das Lehrbuch „Physikalische Chemie – Eine Einführung nach
neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten“, das auch ins Englische übersetzt wurde.
Ergänzend wurde das vorliegende Arbeitsbuch mit zahlreichen Übungsaufgaben und den
zugehörigen ausführlichen Lösungen verfasst.
Regina Rüffler studierte Chemie an der Universität des
Saarlandes und promovierte dort 1991 bei U. Gonser. Von
1989 bis 2002 war sie Dozentin am Institut für Physikalische
Chemie der Universität Hamburg, unterbrochen von einem
zweijährigen Aufenthalt als Gastwissenschaftlerin an
der Universität des Saarlandes. Während ihrer Dozentur
betreute sie zahlreiche Lehrveranstaltungen im Grund- und
Hauptstudium wie Vorlesungen, Praktika und Übungen.
Ihre Begeisterung für die Lehre ließ sie 2002 in die
Eduard-Job-Stiftung eintreten. Neben der Abfassung des
Lehr- sowie des Arbeitsbuches „Physikalische Chemie“ in
Zusammenarbeit mit G. Job erstellt sie Versuchsbeschreibungen zu den über hundert
in das Lehrbuch integrierten Demonstrationsexperimenten und produziert zugehörige
Videos, für die sie mehrfach Preise gewonnen hat (https://job-stiftung.de/index.
php?versuche-1). Auch wurde das neue Lehrkonzept in all seinen Facetten von ihr auf
zahlreichen Konferenzen im In- und Ausland vorgestellt und seit 2012 an der Universität
Hamburg in der Experimentalvorlesung „Thermodynamik“ für Studierende der
Holzwirtschaft umgesetzt.
Georg Job · Regina Rüffler
Arbeitsbuch
Physikalische Chemie
Aufgaben zum Lehrbuch
mit ausführlichen Lösungen
Georg Job Regina Rüffler
Job-Stiftung Job-Stiftung
Hamburg, Deutschland Universität Hamburg
Hamburg, Deutschland
ISSN 2627-2970 ISSN 2627-2989 (electronic)
Studienbücher Chemie
ISBN 978-3-658-25109-3 ISBN 978-3-658-25110-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25110-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch
die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des
Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und
Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Planung: Rainer Münz
Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und
ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Das Arbeitsbuch bietet in Ergänzung zum Lehrbuch „Physikalische Chemie. Eine Einführung
nach neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten“ die ausgezeichnete Möglichkeit, den
erarbeiteten Stoff durch Auseinandersetzung mit einer konkreten Problemstellung einzuüben
und so das Verständnis zu vertiefen. Es gliedert sich in einen Aufgabenteil und einen an-
schließenden Lösungsteil.
Der Aufgabenteil umfasst knapp 200 Übungsaufgaben, die sich thematisch an das Lehrbuch
anschließen. Aufgaben mit einem höheren Schwierigkeitsgrad sind dabei mit einem * mar-
kiert. Die mit † gekennzeichneten Aufgaben basieren auf Vorlagen von Prof. Friedrich Herr-
mann.
Bei der Bearbeitung der Aufgaben, bei denen als Ergebnis ein Zahlenwert verlangt wird,
empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise: Zunächst wird die allgemeine Formel angege-
ben, dann werden, um Rechenfehler zu vermeiden, die Größenwerte in SI-Einheiten (mit
entsprechendem Vorzeichen) eingesetzt, also das Volumen nicht etwa in Litern, sondern in
m3, die Masse nicht in g, sondern in kg usw. Abschließend wird das Endergebnis berechnet.
Bei Zwischenrechnungen ist es zweckmäßig, die Einheitenvorsätze (außer k beim kg) als
Zehnerpotenzen auszuschreiben und die Vorsätze erst im Endergebnis wieder zu benutzen.
Im Anschluss an den Aufgabenteil werden im Lösungsteil die Rechenwege zu allen Aufgaben
Schritt für Schritt ausführlich erläutert. Kurze Zwischenrechnungen (punktiert-gestrichelt
unterstrichen) wurden in die Berechnung der gesuchten Größe eingeschoben, längere Zwi-
schenrechnungen vorangestellt.
Die Nummern der Gleichungen beziehen sich auf das Lehrbuch „Physikalische Chemie. Eine
Einführung nach neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten“, das 2011 im Rahmen der
Studienbücher Chemie im Vieweg+Teubner Verlag (heute Springer-Verlag) erschienen ist.
Beim Vorstand der Job-Stiftung möchten wir uns herzlich für die stete Unterstützung und die
große Geduld bedanken. Unser ganz besonderer Dank gilt jedoch Eduard J. Job†, der die Job-
Stiftung 2001 gründete, und seinem Bruder Norbert Job, der seit 2017 die Finanzierung der
Stiftung übernommen hat. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Springer-Verlags sind
wir für die stets gute Zusammenarbeit sehr dankbar.
Hamburg, im November 2018 Georg Job, Regina Rüffler
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgabenteil 1
1.1 Einführung und erste Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Entropie und Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 Chemisches Potenzial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5 Einfluss von Temperatur und Druck auf Stoffumbildungen . . . . . . . . . . . . 13
1.6 Massenwirkung und Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials . . 16
1.7 Konsequenzen der Massenwirkung: Säure-Base-Reaktionen . . . . . . . . . . . 22
1.8 Begleiterscheinungen stofflicher Vorgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.9 Querbeziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.10 Dünne Gase aus molekularkinetischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.11 Übergang zu dichteren Stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.12 Stoffausbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.13 Gemische und Gemenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.14 Zweistoffsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.15 Grenzflächenerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.16 Grundzüge der Kinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.17 Zusammengesetzte Reaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.18 Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.19 Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.20 Transporterscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1.21 Elektrolytlösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.22 Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.23 Redoxpotenziale und galvanische Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2 Lösungsteil 85
2.1 Einführung und erste Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2 Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.3 Entropie und Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.4 Chemisches Potenzial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.5 Einfluss von Temperatur und Druck auf Stoffumbildungen . . . . . . . . . . . . 112
2.6 Massenwirkung und Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials . . 120
2.7 Konsequenzen der Massenwirkung: Säure-Base-Reaktionen . . . . . . . . . . . . 138
2.8 Begleiterscheinungen stofflicher Vorgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2.9 Querbeziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
2.10 Dünne Gase aus molekularkinetischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.11 Übergang zu dichteren Stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
VIII Inhaltsverzeichnis
2.12 Stoffausbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2.13 Gemische und Gemenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.14 Zweistoffsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2.15 Grenzflächenerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
2.16 Grundzüge der Kinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
2.17 Zusammengesetzte Reaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
2.18 Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2.19 Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
2.20 Transporterscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
2.21 Elektrolytlösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
2.22 Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.23 Redoxpotenziale und galvanische Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
1 Aufgabenteil
1.1 Einführung und erste Grundbegriffe
1.1.1 Stoffmengenkonzentration
In 500 cm3 einer wässrigen Lösung (L) von Glucose (Stoff B; C H O ) sind 45 g dieses
6 12 6
Zuckers gelöst. Wie groß ist die Stoffmengenkonzentration c der Lösung?
B
Hinweis: Die molaren Massen M der betrachteten Stoffe werden in der Regel nicht an-
gegeben, da sie bei bekannter Gehaltsformel leicht zu berechnen sind: Sie entsprechen den
Summen aus den molaren Massen (deren Zahlenwert gleich den relativen Atommassen ist)
der die Verbindung aufbauenden Elemente, multipliziert mit den zugehörigen Gehaltszahlen.
So besteht Glucose aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff mit den mola-
ren Massen 12,0 ⋅ 10−3 kg mol−1, 1,0 ⋅ 10−3 kg mol−1 und 16,0 ⋅ 10−3 kg mol−1. Die molare
Masse M der Glucose ergibt sich schließlich zu (6 ⋅ 12,0 + 12 ⋅ 1,0 + 6 ⋅ 16,0) ⋅ 10−3 kg mol−1 =
B
180,0 ⋅ 10−3 kg mol−1.
1.1.2 Massen- und Stoffmengenanteil
Ein Volumen von 100 mL Kochsalzlösung [Lösung L; bestehend aus Natriumchlorid (Stoff
B) und Wasser (Stoff A)] enthält bei 25 °C 15,4 g des gelösten Salzes. Berechnen Sie den
Massenanteil w und den Stoffmengenanteil x , wenn die Dichte der Kochsalzlösung ρ =
B B L
1,099 g mL−1 beträgt.
1.1.3 Massenanteil
Schnaps kann vereinfachend als ein Gemisch aus Ethanol (Stoff A) und Wasser
(Stoff B) angesehen werden. Wir wollen einen „Schnaps“ mit einem Massenan-
teil w von 33,5 % an Alkohol herstellen, was einer im Spirituosenhandel übli-
A
chen Gehaltsangabe von „40 % Vol.“ entspricht. (Einen solchen Alkoholgehalt
weisen z. B. viele Wodkasorten auf.) Dazu stehen uns 100 g Ethanol zur Verfü-
gung. Wie viel Gramm Wasser müssen hinzugefügt werden, um zu dem ge-
wünschten Alkoholgehalt zu gelangen?
1.1.4 Zusammensetzung eines Gasgemisches
Wie groß sind Stoffmengen- und Massenkonzentration, c und β , sowie Stoffmengen- und
B B
Massenanteil, x und w , des Sauerstoffs (Stoff B) in Luft unter Normbedingungen [vereinfa-
B B
chend als ein Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff (Stoff A) zu betrachten, in dem 21 % der
Molekeln O sind]?
2
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
G. Job und R. Rüffler, Arbeitsbuch Physikalische Chemie, Studienbücher Chemie,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25110-9_1
2 1 Aufgabenteil
Hinweis: Gehen Sie der Einfachheit halber von einer Luftmenge von 1 mol aus und beachten
Sie, dass 1 mol eines beliebigen Gases, sei es rein oder gemischt, unter Normbedingungen
[298 K (25 °C), 100 kPa (1 bar)] rund 24,8 L einnimmt.
1.1.5* Umrechnungsbeziehungen
In Tabelle 1.1 im Lehrbuch „Physikalische Chemie“ sind Umrechnungsbeziehungen der ge-
bräuchlichsten Zusammensetzungsgrößen für binäre Gemische aus zwei Komponenten A und
B angegeben. Zeigen Sie, dass der folgende, in der zweiten Spalte der ersten Zeile stehende
Ausdruck gleich x ist:
B
M c
A B .
ρ−c (M −M )
B B A
1.1.6 Beschreibung des Reaktionsablaufs
Die Ammoniaksynthese ist das wichtigste industrielle Verfahren zur Umwandlung des kaum
reaktiven Luftstickstoffs in eine nutzbare Stickstoffverbindung, denn aus Ammoniak kann
z. B. Kunstdünger hergestellt werden. Wir betrachten nun die Bildung von Ammoniak in
einem Durchflussreaktor im stationären Betrieb während einer kurzen Weile:
Stoffkürzel B B′ D
Umsatzformel: N |g + 3 H |g → 2 NH |g
2 2 3
Stand der Umsetzung: ξ(10h10m) = 13 mol, ξ(10h40m) = 19 mol
Zur besseren Übersichtlichkeit werden hier und im Folgenden statt der vollständigen Stoff-
namen oder –formeln geeignete Kürzel verwendet.
a) Wie lauten die Umsatzzahlen ν , ν und ν ?
B B′ D
b) Wie groß ist der Umsatz Δξ in der betrachteten Zeitspanne?
c) Wie groß sind die Mengen- und Massenänderungen aller beteiligten Stoffe in dieser Zeit?
1.1.7 Anwendung der stöchiometrischen Grundgleichung bei Titrationsverfahren
250 mL einer Schwefelsäurelösung (Stoff B; H SO ) mit unbekannter Konzentration c
2 4 B,0
werden in einem Erlenmeyerkolben vorgelegt, mit einigen Tropfen einer Phenolphthalein-
Lösung als Säure-Base-Indikator versetzt und anschließend mit Natronlauge (Stoff B′; NaOH)
der Konzentration c = 0,1 kmol m−3 bis zum Farbumschlag von farblos nach rosaviolett
B′,0
titriert. Der Verbrauch an Natronlauge bis zum Äquivalenzpunkt beträgt 24,40 mL.
a) Formulieren Sie die Umsatzformel für die zugrunde liegende Säure-Base-Reaktion und
die zugehörige stöchiometrische Grundgleichung.
b) Geben Sie die Stoffmengenkonzentration c der Schwefelsäurelösung an.
B,0
c) Berechnen Sie die Masse m an H SO (in mg), die in ihr enthalten ist.
B,0 2 4
Description:Das Arbeitsbuch bietet in Ergänzung zum Lehrbuch "Physikalische Chemie - Eine Einführung nach neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten" die ausgezeichnete Möglichkeit, den erarbeiteten Stoff durch Auseinandersetzung mit konkreten Problemstellungen einzuüben und zu vertiefen. Im Anschluss an de