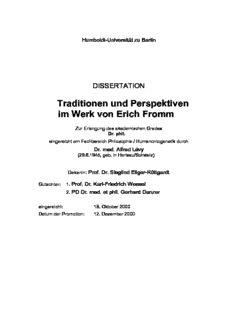
2000-12-12Dissertation Traditionen und Perspektiven im Werk von Erich Fromm Lévy, Alfred Erich ... PDF
Preview 2000-12-12Dissertation Traditionen und Perspektiven im Werk von Erich Fromm Lévy, Alfred Erich ...
Humboldt-Universität zu Berlin DISSERTATION Traditionen und Perspektiven im Werk von Erich Fromm Zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. eingereicht am Fachbereich Philosophie / Humanontogenetik durch Dr. med. Alfred Lévy (29.6.1945, geb. in Herisau/Schweiz) Dekanin: Prof. Dr. Sieglind Ellger-Rüttgardt Gutachter: 1. Prof. Dr. Karl-Friedrich Wessel 2. PD Dr. med. et phil. Gerhard Danzer eingereicht: 18. Oktober 2000 Datum der Promotion: 12. Dezember 2000 2 Abstract zu „Traditionen und Perspektiven im Werk Erich Fromms“ Erich Fromms (1900-1980) Quellen werden aus seiner Biographie, dem Gedankengut der jüdischen Religion (vor allem der Propheten und des Talmud), der Soziologie Alfred und Max Webers, der religiösen und philosophischen Humanisten, des frühen Karl Marx und der Psychoanalyse Freuds erschlossen und anhand seines Werkes dargestellt und erörtert. Es folgen in chronologischer Reihenfolge Analysen von Fromms Beiträgen zu einer ethisch inspirierten Psychoanalyse, zur analytischen Sozialpsychologie, zur jüdischen, christlichen und buddhistischen Religionspsychologie und seinem Konzept einer nicht-theistischen, humanistischen Religion, zum Matriarchat, zum Marxismus und dem daraus abgeleiteten humanitären, „kommunitären“ Sozialismus, zur Kulturanalyse, Kulturkritik und zum Humanismus. Detailliert wird auf Fromms berühmte sozialpolitische und kulturhistorische Untersuchungen des Mittelalters, der Renaissance, des Protestantismus, des Kapitalismus, des Nationalsozialismus, des Kommunismus, der Technik und der destruktiven Aggression eingegangen, welche zu seinen bekannten Begriffen des „Gesellschaftscharakters“, des „Konsum-“ und „Marketing-Charakters“ sowie der „Nekrophilie“ führten. Fromms umfangreiches Werk wird abschließend gewürdigt und vor allem in den Bereichen der Sozialpsychologie, Aggressionstheorie und Pädagogik kritisiert, indem seine Konzepte auf die moderne Jugend des Jahres 2000 und den heutigen Gesellschaftscharakter angewandt werden. Methodisch wurde kritisch-historisch, religionspsychologisch und tiefenpsychologisch (psychoanalytisch und individualpsychologisch) vorgegangen. Erich Fromm, humanistische Psychoanalyse, Sozialpsychologie, kommunitärer Sozialismus, Kulturanalyse, Aggressionstheorie, Sozialcharakter. Abstract to „Traditions and Perspectives in the Work of Erich Fromm“ Erich Fromms (1900-1980) sources are disclosed of his biography, of his judaistic thoughts (especially of des prophets and the talmud), of the sociologic concepts (Alfred and Max Weber), of the religious and philosophical humanists, of the early Karl Marx and of the psychoanalysis Sigmund Freuds. The analysis follows in chronologic order Fromms concepts of an ethical inspired psychoanalysis, of his socialpsychology, of his judaistic, christian and buddhist psychology of religion, of his project of an non-theistic humanistic religion, of the matriarchat, oft the Marxism and the derived humanistic „communitarian“ Socialism, of the culture-analysis and –critique. In detail are Fromms famous sociopolitical researches on the Middle Ages, the Renaissance, the Protestantism, the Kapitalism, the Nationalsocialism, the Kommunism, the technic and the aggression (destructivity) described. This leads to the terms of the „social-character“, the „consum- and marketing-charakter“ and the „necrophily“. The work ends with the valuation and critique of Fromms ouevre especially in the parts of the socialpsychology, the theory of aggression and pedagogy. The evaluation is made with the character of the modern youth of the year 2000 and the modern social-character. As methods are used: history and critique of religion, depth-psychology (psychoanalysis and individualpsychology). Erich Fromm, humanistic psychoanalysis, social psychology, communitarian socialism, analysis of culture, theory of aggression, social character. 3 Inhalt FRAGESTELLUNG, HYPOTHESEN UND METHODIK.....................................................6 EINLEITUNG 8 BIOGRAPHISCHES ZU ERICH FROMM...........................................................................9 1. VON DER PSYCHOANALYSE ZUR ANALYTISCHEN SOZIALPSYCHOLOGIE......16 1.1. Religionspsychologie und Psychoanalyse..............................................................16 1.1.1.Jüdische Religionspsychologie.........................................................................16 1.1.2.Christliche Religionspsychologie.......................................................................18 1.2. Grundlegung einer Sozialpsychologie und der Übervater Freud...........................20 1.2.1.Sigmund Freud, der Übervater..........................................................................23 1.2.2.Analytische Ethnologie und Ödipus-Komplex...................................................29 1.3. Analytische Sozialpsychologie...............................................................................30 1.3.1.Karl Marx und die Psychoanalyse.....................................................................30 1.3.2.Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie...........................31 1.3.3.Abgrenzung von Freuds Psychoanalyse...........................................................33 1.4. Studien über Autorität und Familie. Die Konzeption des Gesellschaftscharakters35 1.5. Kritik an und Konkurrenz mit Kollegen...................................................................38 2. VOM JUDENTUM UND CHRISTENTUM ZUR RELIGION OHNE GOTT...................41 2.1. Radikale Religionskritik...........................................................................................41 2.2. Psychoanalyse und Religion oder von der autoritären zur humanistischen Religion. 43 2.3. Auf der Suche nach der Universalsprache: Märchen, Mythen, Träume................50 2.4. Die Aktualität der Propheten — Fromms alt-neues Bündnis mit dem Alten Testament und dem Zen-Buddhismus...........................................................................56 2.5. Blasphemie oder eine neue Religion? — „Ihr werdet sein wie Gott“......................62 2.6. Freud und Marx als „atheistisch-religiöse Denker“.................................................68 3. VOM BEITRAG DES MATRIARCHATS ZUM MARXISMUS UND VOM MARXISTISCHEN ZUM KOMMUNITÄREN SOZIALISMUS...........................................70 3.1. Plädoyer für eine Renaissance des Matriarchats...................................................70 3.2. Das Marxsche Menschenbild und der historische Materialismus. Der Begriff der Arbeit und der Produktivität im Sinne von Marx.............................................................75 3.3. Entfremdung...........................................................................................................80 3.4. Der Marxsche Sozialismus.....................................................................................81 3.5. Die humanistische Psychoanalyse und ihr Konzept für eine gesunde Gesellschaft 85 3.6. Der Roboter-Mensch des 20. (und 21.) Jahrhunderts............................................87 3.7. Wege aus einer kranken Gesellschaft. Die Irrtümer und Widersprüche von Marx.89 3.8. Der kommunitäre Sozialismus als Weg zu einer gesunden Gesellschaft..............91 3.9. Fromms sozialistisches Manifest und Programm aus dem Jahre 1960: Den Vorrang hat der Mensch!...............................................................................................95 4. KULTURANALYSE UND KULTURKRITIK..................................................................97 4.1. Geschichtliches und Begriffsklärung......................................................................97 4.1.1.Zur Geschichte der Kulturkritik..........................................................................97 4.1.2.Normal, gesund, krank oder neurotisch — gelten diese Begriffe auch für die Gesellschaft?98 4.2. Der Staat als Erzieher. Zur Psychologie der Strafjustiz.........................................99 4.3. Zur Psychologie des ohnmächtigen Kleinbürgers................................................101 4.4. Die Furcht vor der Freiheit....................................................................................103 4 4.5. Kulturanalyse des Mittelalters und der Reformation.............................................104 4.6. Flucht ins Autoritäre, Destruktive oder Konformistische.......................................107 4.7. Nationalsozialismus, Hitler und die Nekrophilie....................................................110 4.7.1.Psychologie des Nazismus und des Kleinbürgers Hitler.................................110 4.7.2.Hitler als Prototyp des Nekrophilen.................................................................111 4.8. Das Doppelgesicht der Freiheit in der Moderne...................................................113 4.8.1.Kulturanalyse und Kulturkritik der demokratischen Gesellschaft....................113 4.8.2.Kulturanalyse der technisierten Gesellschaft. Irrationale und rationale Autorität. 115 4.9.Aggression, Destruktivität und Nekrophilie in der Gesellschaft.............................117 4.10. Sozial-politische Stellungnahmen.......................................................................122 5. VISIONEN EINES NEUEN HUMANISMUS................................................................127 5.1. Grundzüge einer humanistischen Ethik................................................................127 5.1.1.Die Natur des Menschen und dessen Möglichkeit, einen produktiven Charakter zu entwickeln128 5.1.2.Selbstsucht und Selbstliebe............................................................................130 5.1.3.Autoritäres und humanistisches Gewissen.....................................................131 5.1.4.Lust, Glück und Glauben.................................................................................131 5.1.5.Das Böse: Neurose oder Defekt? Absolute und relative (humanistische) Ethik. 132 5.1.6.Ist der Mensch gut oder böse?........................................................................133 5.2. Geschlecht und Charakter. Die Kunst des Liebens..............................................136 5.2.1.Defiziente und echte Formen der Liebe..........................................................138 5.2.2.Liebe zwischen Eltern und Kind; Ablösung von der Familie...........................139 5.2.3.Die Liebesobjekte: der Nächste, das Kind, der Partner, das Selbst und Gott140 5.2.4.Der Verfall der Liebe in der westlichen Welt...................................................141 5.2.5.Hohe Schule der Liebeskunst.........................................................................142 5.3. Der Beitrag der Psychoanalyse zum Humanismus..............................................142 5.4. Der Mensch ist kein Ding, sondern ein Wert........................................................145 5.5. Sozio-politischer Humanismus: Der gesunde Mensch und die gesunde Gesellschaft 147 5.6. Zum Programm eines neuen Humanismus..........................................................150 6. AUSBLICK UND KRITISCHE WÜRDIGUNG: FROMMS BEITRÄGE ZUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, SOZIOLOGIE, PÄDAGOGIK, INTERDISZIPLINARITÄT UND HUMANISTISCH-SOZIALPOLITISCHEN PRAXIS...............................................157 6.1 Basis des Frommschen Denkens: Die jüdische Sozialisation...............................157 6.1.1.Religionspsychologische Erwägungen............................................................158 6.1.2..Zur Rezeptionsgeschichte von Fromms Religionspsychologie.....................160 6.2 Analytische Sozialpsychologie..............................................................................161 6.2.1.Die „Kritische Theorie“ und der Gesellschaftscharakter.................................162 6.2.2.Symboltheorie, Interaktionslehre und Sprache...............................................163 6.3 Aggressionstheorie................................................................................................165 6.3.1.Neo-marxistische Analyse der Aggression.....................................................165 6.3.2.Sozialanalytische Theorie der Aggression; Kritik der Frommschen Thesen..168 6.4 Pädagogik169 6.5 Gibt es einen modernen Gesellschaftscharakter?.................................................174 6.5.1.Der moderne Marketing-Charakter.................................................................176 6.5.2.Ost- und westdeutscher Gesellschaftscharakter?..........................................177 6.5.3.Kindheit und Jugend 2000 in Deutschland.....................................................178 6.5.4.Die Generation Golf.........................................................................................180 6.5.5.Jugend 2000....................................................................................................181 6.6 Abschließende Bemerkungen................................................................................183 7. ZUSAMMENFASSUNG..............................................................................................186 5 8. LITERATURVERZEICHNIS........................................................................................187 9. CHRONOLOGISCHES SCHRIFTENVERZEICHNIS ERICH FROMMS MIT BANDANGABEN DER GESAMTAUSGABE (DVA UND DTV 1980/81; 1989; 1999; JAHRESZAHL IN KLAMMERN: SCHRIFTEN AUS DEM NACHLAß, NEU-EDITION)193 Anmerkung zur Textgestaltung: In den einzelnen Kapiteln sind die Veröffentlichungen fett und kursiv ausgedruckt, wenn sie das erste Mal zitiert und kommentiert werden. Seine Werke werden größtenteils aus der Gesamtausgabe (Kürzel: GA, Bandzahlen arabisch), Hrsg. von Rainer Funk, Stuttgart 1980/1981, zitiert. 6 Fragestellung, Hypothesen und Methodik In der folgenden Arbeit ist beabsichtigt, folgende Fragen zu beantworten: 1 Aus welchen kulturgeschichtlichen Quellen speist sich die Psychologie und Soziologie Fromms? 2 Welche Auswirkungen haben diese geisteswissenschaftlichen Voraussetzungen auf das humanistische, religiöse, soziologische und psychologische Denken Fromms? 3 Wir wirkte sich Fromms religiöse Sozialisation auf seine wissenschaftliche Terminologie aus? 4 Inwieweit sind Fromms Begriffe des Gesellschaftscharakters und der Charakterologie noch heute in der Soziologie und Psychologie an- und verwendbar? 5 Sind Fromms sozial-politische Utopien realisierbar und, wenn ja, mit welchen Modifikationen? Im Verlauf der Untersuchung werden folgende Hypothesen aufgestellt und — soweit möglich — überprüft: A Die jüdisch-religiöse Sozialisation war prägend für Werk und Leben Erich Fromms. Aus ihr resultieren persönliche, idealistische und wissenschaftliche Orientierungen am „Sein“, am humanitären und kommunitären Sozialismus sowie dualistisch-dichotome Konzepte wie „rational-irrational“, „Biophilie-Nekrophilie“ oder „Haben-Sein“. B Als Angehöriger einer Minderheit war Fromm dazu prädestiniert, gegen den „Mainstream“ des Patriarchats (Autoritarismus), des Nationalismus und der traditionellen Glaubensbekenntnisse anzukämpfen. Der Marxismus erwies sich dabei als tragfähiges Fundament in der Auseinandersetzung mit dem in der Gesellschaft vorherrschenden Kapitalismus. C Andererseits trugen die ängstlich-verwöhnende und religiöse Erziehung durch die Eltern zu konservativen und narzißtischen Zügen bei, die sich als Originalitäts- Streben und im Alter als verstärkte religiöse und mystische Glaubensinhalte manifestierten. D Als Einzelkind hatte Fromm Mühe, sich in eine Gemeinschaft von Gleichaltrigen (z.B. Kolleginnen und Kollegen) einzufügen, obwohl er sich stets darum bemühte. Eine gewisse Fremdheit ist deshalb auch an seinen Begriffen festzustellen: Fromm nennt z.B. das Soziale „Bezogenheit“ (die in C konstatierte Originalitäts- Sucht spielt dabei ebenfalls eine Rolle). E Der Begriff des von Fromm eingeführten „Gesellschaftscharakters“ ist noch immer wissenschaftlich relevant. F Die Begriffe „Nekrophilie“ und „Marketing-Charakter“ sind nicht präzise und verführen zu Spekulationen. Noch fataler wirkt sich dies an Fromms Interpretation von nicht-theistischer „Religiosität“ aus, die er z.B. auch Atheisten attestiert. Dieser Mißgriff führte ihm zwar viele nach Halt suchende Anhänger zu, diskreditierte aber sein wissenschaftliches Renommee. Methodisch wurde in dieser Arbeit kritisch-historisch sowie religionspsychologisch und tiefenpsychologisch (psychoanalytisch und individualpsychologisch) vorgegangen. Aus der bei Fromm vorliegenden Verbindung zwischen Soziologie und Psychoanalyse ergab es sich, daß psychoanalytisch interpretierende Soziologen, „Kritische Theorie“ und hermeneutisch operierende Analysen ebenfalls einbezogen wurden. Die Teile 1 bis 6 befassen sich werkimmanent mit den wichtigsten Schriften Fromms, wobei chronologisch in den jeweiligen Themen vorgegangen wurde. Nach der Einleitung wird in die Biographie Fromms eingeführt. Teil 1 befaßt sich mit Fromms grundlegenden Schriften, die seine besondere Position als Religionspsychologe, Psychoanalytiker, Marxist und Mitbegründer des Instituts für Sozialforschung verdeutlichen. Darin wird auch die lebenslange 7 Auseinandersetzung, Abgrenzung und Abhängigkeit von Freud dargelegt. Teil 2 enthält Fromms religionskritische und religionsreformerische (religionsstiftende?) Schriften und seine Stellungnahmen zu Märchen, Mythen und Träumen. Teil 3 geht von Fromms Schriften zum Matriarchat aus und leitet über zu seiner Marxismus-Rezeption sowie seinem Entwurf eines kommunitären Sozialismus. Teil 4 beinhaltet die Diskussion Fromms bekanntester Schriften, die sich mit den Gesellschaftsstrukturen des Mittelalters, der Reformation, des Faschismus, der Demokratie und der technisierten Demokratie befassen. Das Phänomen der Aggression wird im Zusammenhang mit Hitler, der Nekrophilie und Fromms Buch über die Destruktivität behandelt. Teil 5 geht von den ethischen Positionen Fromms aus und erläutert sein Konzept des liebenden, produktiven und humanistischen Charakters als Grundlage einer gesunden Gesellschaft. Fromms psychoanalytische und sozio-politische Arbeiten zum Humanismus werden inhaltlich dargestellt und kommentiert. Teil 6 präzisiert die in den vorangegangenen Teilen entstandene Kritik und ergänzt sie durch Stellungnahmen von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen zu den Themen der Religion, Sozialpsychologie, Aggressionstheorie und Pädagogik. Es wird auch versucht, Fromms Begriff des Gesellschaftscharakters auf die Moderne anzuwenden. Die abschließenden Bemerkungen beabsichtigen, Fromms Schwächen und Verdienste noch einmal zusammenzufassen. 8 Einleitung Noch anläßlich des 100. Geburtstages von Erich Fromm (am 23. März 2000) erregten Name und Werk dieses Neo-Psychoanalytikers und Sozialpsychologen breit gefächerten Widerspruch. Die Urteile reichten von „intellektueller Anspruchslosigkeit“ und „zu Buchlängen aufgeschwemmten Predigten guten Wollens“ (Michael Rutschky, TAZ Berlin) über eigene „Neurose im Namen Gottes“ (Lorenz Jäger in der FAZ) bis zur Einschätzung von Richard Herzinger (Tagesspiegel Berlin), daß Fromm „ein ganz und gar ernstzunehmender, wenn nicht bedeutender Sozialwissenschaftler (war), der die Geschichte einer der wichtigsten intellektuellen Gruppierungen des vergangenen Jahrhunderts mitgeprägt hat“ (gemeint ist die „Frankfurter Schule“ des Instituts für Sozialforschung unter der Leitung von Max Horkheimer). So kommt es, daß z.B. Werner Herkner im Lehrbuch Sozialpsychologie1 Erich Fromm nicht einmal im Personenregister erwähnt, geschweige denn dessen Errungenschaften und Theorien bespricht. In der vorliegenden Arbeit soll daher versucht werden, anhand von Analyse und Kritik des Frommschen Ouevres zu einem differenzierten Urteil zu gelangen. Da sich Fromms Forschung nicht nur einer wissenschaftlichen Disziplin widmete, ist es erforderlich, das Spektrum der Untersuchungen auf zahlreiche Gebiete wie Psychoanalyse, Sozialpsychologie, Anthropologie, Sozialismus, Marxismus, Religion und Kulturkritik auszudehnen. Dabei wird keine Vertiefung in diesen Wissenschaften angestrebt, sondern der Versuch unternommen, die Interdisziplinarität darzulegen sowie Werk und Autor unter Berücksichtigung der damit verbundenen Widersprüche, Polaritäten und Paradoxien als Einheit zu erfassen. Berlin, September 2000 1 Herkner, Werner: Lehrbuch Sozialpsychologie. Bern, Stuttgart, Toronto 1991 9 Biographisches zu Erich Fromm Im Werk von Erich Fromm finden sich nur wenige autobiographische Angaben, doch hat der Herausgeber der Frommschen Werke, Rainer Funk, mehrere biographische Texte verfaßt. Darauf werden wir uns in der Folge hauptsächlich stützen. Es handelt sich dabei um die Einleitung in die Gesamtausgabe2 (1980/1981;1999), des weiteren um das Buch Mut zum Menschen und Erich Fromm in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten3. Funk war der letzte Assistent von Fromm, der ihm in seinen späten Jahren bei der Ausarbeitung seiner Alterswerke hilfreich zur Seite stand. Er hat sich auch seit dem Tode seines Mentors im Jahre 1980 intensiv um die Herausgabe von dessen sämtlichen Werken bemüht. Des weiteren ist er derzeit Präsident der Internationalen Erich Fromm- Gesellschaft. Erich war das einzige Kind jüdischer Eltern und wurde am 23. März 1900 in Frankfurt am Main geboren. Das Judentum spielte in der Familie eine große Rolle, gab es doch unter seinen Großvätern bekannte und sogar berühmte Rabbiner. Er erhielt deshalb auch eine intensive Ausbildung im Alten Testament und dem Talmud, einem Kompendium von Aussagen und Diskussionen jüdischer Gelehrter, die über viele Jahrhunderte hinweg gesammelt wurden. So kam es, daß auch Erich Fromm in der Kindheit den leidenschaftlichen Wunsch hegte, Talmudgelehrter zu werden. Sein Vater wird als überängstlich in gesundheitlichen Fragen, seine Mutter als depressiv, besitzergreifend und dominant beschrieben. Wahrscheinlich erreichte sie damit, daß sich ihr Sohn zeitlebens mit dem Mutterrecht und dem Patriarchat befaßte, wobei er mehrheitlich das Patriarchat bekämpfte. Er beschäftigte sich aber auch mit der „bösartigen inzestuösen Beziehung“ zur Mutter, die seiner Meinung nach zur Nekrophilie (Liebe zum Toten) führt. Trotz Schulbesuch und Umgang mit zahlreichen christlichen Kameraden sowie wacher Anteilnahme am Zeitgeschehen bezeichnete sich Fromm als „vormodern“, d.h. zahlreichen alten Einsichten verhaftet. Dies zeigte sich vor allem auch in seinem Interesse für die Geschichten der Bibel, wobei er prophetische Schriften oder Beschreibungen von Ungehorsam gegen Obrigkeiten, aber auch harmonische und friedliche Geschichten bevorzugte. Fromm erinnert sich, daß ihn als Pubertierenden der Selbstmord einer 25- jährigen Frau erschütterte, die mit ihrem verwitweten Vater, der starb, beerdigt werden wollte. Das war einer der Gründe, warum ihn die Psychologie — und darunter insbesondere die in der Psychoanalyse Freuds besonders problematisierten Eltern-Kind- Beziehungen — in der Studentenzeit bereits anzog. Sein größtes Interesse galt jedoch jahrelang dem Religions- und Thorastudium. Vor allem wurde für ihn in Frankfurt der Rabbiner Dr. Nehemia Anton Nobel (1871-1922) wichtig, der auch weitläufig philosophisch gebildet war. Während seiner Studentenzeit (ab 1919) besuchte er des weiteren fünf Jahre lang täglich Rabbi Dr. Salman Baruch Rabinkow (geboren 1882) in Heidelberg, wo Fromm Soziologie studierte. Über Rabinkow lernte er auch den radikalen russischen Sozialismus kennen, da ein bekannter Sozialist (Issak Steinberg) zu dessen Schülern gezählt hatte. Fromms soziologische Doktorarbeit4 befaßte sich denn auch mit einem jüdischen Thema: Er untersuchte drei Diasporagemeinden sozial-psychologisch und stellte fest, daß nur die Chassidim ihr „religiöses Eigenleben in die soziologische Struktur des Judentums“ einfügten, während z.B. die Reformjuden die Sphäre des Religiösen dogmatisierten. Gegen Ende seines Studiums löste sich Fromm von der jüdischen Religionspraxis, ohne jedoch Atheist zu werden. Er schreibt später, er sei stets religiös 2 Funk, Rainer: Zu Leben und Werk Erich Fromms. In: Fromm, Erich: Gesamtausgabe (GA). Stuttgart 1980. Bd. 1 3 Ders.: Mut zum Menschen – Erich Fromms Denken und Werk, seine humanistische Religion und Ethik, Stuttgart 1978 Ders.: Erich Fromm mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (1983), Reinbek bei Hamburg 1998 4 EF: Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diasporajudentums (1922). In: GA 1999, Bd. 11, S.19 10 geblieben, aber ohne Glauben an Gott5. Er selbst nennt seine Position eine „nicht- theistische Mystik“6. Dabei stützte er sich auf die „negative Theologie“ eines Maimonides und des Neukantianers Hermann Cohen (Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums). Auch Georg Grimm (Die Lehre des Buddha. Die Religion der Vernunft, Die Wissenschaft des Buddhismus) wies ihm den Weg zu einer Religion ohne einen persönlichen Gott. Die Massenhysterie des Ersten Weltkriegs steckte den Pubertierenden nicht lange an. Es imponierte ihm, wie einer seiner bewunderten Lehrer gegen den auch unter den Schülern grassierenden Nationalismus und Ausländerhaß Stellung bezog, indem er ihnen ruhig mitteilte, daß sie sich nichts vormachen sollten: England hätte noch niemals einen Krieg verloren. Wahrscheinlich orientierte er sich bereits an den Rebellen, welche sich mutig gegen die übliche Ideologie und Orthodoxie wandten. Nach dem Abitur entschied sich Fromm zunächst für ein Jurastudium, das ihn aber nach wenigen Semestern langweilte. Nun trat hauptsächlich sein soziologisch- philosophisches Interesse in den Vordergrund, und seit 1919 studierte er Soziologie, Psychologie und Philosophie in Heidelberg. Dort lehrten Heinrich Rickert, Karl Jaspers, Max und Alfred Weber und manch anderer namhafter Gelehrte. Durch die oben genannten Glaubenslehrer wurde Fromm auch zur Philosophie von Hermann Cohen (1842-1918) hingeführt, der das Haupt der Marburger Schule des Neukantianismus war. Cohen konnte als einziger Jude die Position eines Ordinarius der Philosophie im Preußen jener Zeit erringen. Er und Paul Natorp (1854-1924) standen für eine Form der Kant-Auslegung, die Kant mit einem religiösen und doch auch wissenschaftlichen Humanismus vereinigte. Diese Bildungsquellen sind für Fromm zeitlebens wichtig geblieben. Auch andere junge jüdische Intellektuelle hatten hier ihren Ausgangspunkt, z.B. Franz Rosenzweig, Ernst Simon, Gerschom Scholem, Siegfried Kracauer und Martin Buber. Mit einigen von ihnen war Fromm befreundet und pflegte einen lebhaften Gedankenaustausch. Bereits zu Beginn seines Studiums faszinierten ihn die Schriften von Karl Marx. Er fand bei ihm einen Sozialismus, der die Selbstwerdung und die Humanisierung des Menschen im Auge hatte. Der Mensch sollte ohne die Tröstungen der Religion zu seinem Wesen befreit werden. Dies alles schien bei Fromm keine Widersprüche auszulösen, als er mit Rabbi Georg Salzberger das „Freie Jüdische Lehrhaus“ (Volkshochschule) gründete, in dem Franz Rosenzweig die Leitung übernahm. In der zionistischen Studentenorganisation (KJV) war Fromm ebenfalls so aktiv, daß man ein Gebet kreierte: „Mach mich wie den Erich Fromm, daß ich in den Himmel komm‘!“ Fromm wandte sich aber bald vom Zionismus ab, da dieser seiner Ansicht eines „universalistischen Messianismus und Humanismus“ widersprach. Ein weiterer Autor fesselte den jungen Studenten ebenfalls seit 1920: Johann Jakob Bachofen. Er hielt an der Universität über dessen Theorie der mutterrechtlichen Gesellschaft ein derart mitreißendes Referat, daß ihm die Kommilitonen Beifall klatschten. Bachofen lieferte ihm das Material, um gegen Freuds patriarchalisch orientierte Gesellschaftsordnung schlagkräftige Argumente zu finden. Fromm erläuterte dies in zahlreichen späteren Werken mit der unterschiedlichen Liebe der Eltern: Die Mutter liebe das Kind ohne Rücksicht auf deren Verdienst; der Vater jedoch nur dann, wenn es ihm gehorche und Leistungen in seinem Sinne vollbringe. Bachofens idealtypische Unterscheidungen waren Fromm auch hilfreich bei der Interpretation des leistungsorientierten Patriarchats und eines Zentralproblems der menschlichen Entwicklung: Die Bedeutung der Sehnsucht nach der Mutter (bei Mann und Frau) und der Mutterbindung. Nach der Promotion 1922 wandte sich Fromm, primär aus eigenen Problemen heraus, intensiv der Psychoanalyse zu. Er lernte Frieda Reichmann (1890 geboren) kennen, die ab 1924 ein privates Sanatorium in Heidelberg betrieb, das sogenannte 5 EF: Ihr werdet sein wie Gott – eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition (1966). In: GA Bd. 6 6 ebd. S.94
Description: